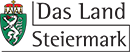Ein Klavier ist nicht genug (*/**)
Die Improvisatorin und Komponistin Elisabeth Harnik liebt das Changieren zwischen musikalischen Ausdrucksformen.
Am Anfang stand ein Klavier. Mit fünf Jahren begann die in Graz geborene Elisabeth Harnik den Unterricht am Tasteninstrument, das zum Wegbegleiter und ersten Fixpunkt ihrer musikalischen Entwicklung wurde. Sich auf die Interpretation von Musik anderer beschränken zu müssen, dafür war sie jedoch nicht der Typ. Noch während sie die klassische Ausbildung zur Pianistin durchlief, rührte sich eine andere kreative Ader. „Der Drang, eigenschöpferisch tätig zu sein, ist einfach größer geworden", erklärt sie. Harnik begann sich mit dem weiten Feld der freien Improvisation zu beschäftigen, hörte intensiv MusikerInnen wie Joëlle Léandre (deren musikalischen Weg von der Klassik hin zur Improvisation sie teilt) und John Butcher, besuchte einschlägige Festivals und klinkte sich im Lauf der Jahre in die Szene ein. Heute gehört sie als Pianistin zu den wenigen Frauen, die sich im Impro-Bereich behaupten können, spielt in diversen Formationen mit namhaften KollegInnen. Dass sie damit auch ein Gebiet zeitgenössischer-avantgardistischer Musik betreten hat, wo der Existenzkampf zur Normalität gehört, zeugt vom Mut der Künstlerin, Schritte zu tun, die „nur" einer ästhetischen Notwendigkeit geschuldet sind.
Das ist die eine Seite von Harniks Schaffen, das Komponieren war jedoch bald zweites Standbein. Auch auf diesem Gebiet ist sie mittlerweile fertig ausgebildet - sie absolvierte auf der Grazer Kunstuniversität ein Kompositionsstudium bei Beat Furrer. Die beiden Sphären ihrer künstlerischen Existenz verschwimmen bei Harnik jedoch nicht, sondern bilden recht deutlich voneinander abgesetzte Tätigkeitsfelder. Musik, die sie schreibt, interpretiert sie so gut wie nie, und sie hat überhaupt kein Bedürfnis, ihre Improvisationen als „Real Time Composing" zu bezeichnen. Elisabeth Harnik liebt gerade die Gegensätzlichkeit von Improvisation und Komposition. „Als Pianistin gehe ich am liebsten ohne Vorgaben, ohne Konzept auf die Bühne. Da werden alle Entscheidungen im Moment getroffen, da gibt es nicht Vornotiertes, auch keine Grafik oder ähnliches. Da gibt es allein meine musikalische Erfahrung." Am Komponieren schätzt sie dagegen die Exaktheit, mit der Musik niedergeschrieben werden kann. Die Künstlerin, die recht abgeschieden nördlich von Graz lebt, tüftelt lange an ihren Kompositionen. Das Springen zwischen verschiedenen Tätigkeiten bildet sich hier in einem enger gesteckten Feld nochmals ab. „Ich schreibe nicht in einem Schwung." Die Projekte bleiben oft liegen, damit sie sich wieder einer anderen Arbeit zuwenden kann. Der Gegensatz zur Impro, wo irreversible musikalische Ströme in Gang gesetzt werden, ist hier nochmals verdeutlicht. Auch wenn sie die Gegensätzlichkeit der Bereiche fasziniert, ist ihr natürlich bewusst, dass solche Konzepte in der musikalischen Wirklichkeit nicht in purer Form existieren. Improvisation findet natürlich nicht in einer Situation völliger Freiheit statt, sondern ist von zahlreichen Einflüssen vorgeprägt. Und die präzise schriftliche Fixierung von Musik lässt den Interpreten noch immer Freiräume der Intuition und Spontaneität.
Mögen die musikalischen Ausdrucksformen zwischen der „freien" Improvisation und der Neuen Musik doch oft verwandtschaftlich klingen, tun sich tatsächlich große Gräben auf. Die Musik kennt wenige Akteure, die sich wie Harnik sowohl in der Neuen Musik als auch in der Impro-Szene heimisch fühlen. Die meisten sind nicht einmal als Nur-Rezipienten am anderen Feld interessiert. Die Interessen der aus einer slowenischen Familie stammenden Künstlerin sind weitergefasst: Seit einiger Zeit beschäftigt sich Harnik auch intensiv mit dem Musiktheater. Zu verdanken ist das einem Treffen mit der Schriftstellerin Olga Flor. Seit einigen Jahren ist das Duo nun als klassische Arbeitsgemeinschaft „Librettistin/Komponistin" tätig. Das von Flor vorgeschlagene Thema fürs gemeinsame Musiktheater war ein Ort, der Kugelstein bei Peggau im Grazer Bergland. Das seit einigen Jahren währende „work in progress" begann mit einer Wanderung auf den Kugelstein. „Ein Ort, in dem viel Dramatik steckt", wie sie findet. Eine größere Szene aus dem breit angelegten Werk wurde vom Grazer Opernhaus aufgeführt. Die Komponistin durfte zu dieser Gelegenheit gleich schlechte Erfahrungen mit der Theaterrealität sammeln, in diesem Fall personifiziert durch ein schwieriges bis unsensibles Regieteam. Wenn man Szenen aus „Kugelstein" hört, verwundert es, dass sich Harnik für die traditionelle Form des Genres Oper nur als Jugendliche begeistern konnte. Harniks Tonspache wirkt - im Vergleich zu jener von vielen ihrer komponierenden KollegInnen - eher der Tradition verpflichtet. „Das liegt vielleicht auch an Olga Flor, sie wollte von Anfang an eine Geschichte erzählen. Mich hat das erst, da ich ja aus der strengen Avantgarde gekommen bin, ziemlich schockiert." Nicht nur die Narration bildet hier ein Gerüst, das bei aller Offenheit fürs Neue an die Konventionen des Genres erinnert, auch die Möglichkeit der Stimme sind in „Kugelstein" auf sehr gekonnte Art ausgehorcht. Vielleicht rührt das Interesse und das Gespür für die menschliche Stimme daher, dass sich Harnik früher parallel zum Klavierstudium in den Jazzgesang vertieft hat. Ein weiteres Beweisstück, wie sich musikalische Vielseitigkeit bezahlt macht, wie diese Musikerin postmoderne Kunst betreibt, nicht unter dem ohnehin falschen Schlagwort von der Beliebigkeit, sondern in vielleicht von ihr als Individuum mitunter kaum selbst wahrzunehmender Korrespondenz von in sich scharf definierten Bereichen.
Martin Gasser
Dezember 2007
*Update 2011
Nein, kein "Kugelstein" mehr seit der Premiere von Teil 2 an der Grazer Oper im Februar 2007. Fast genau vier Jahre später lässt Elisabeth Harnik in der Grazer Helmut-List-Halle mit einer Friederike-Mayröcker-Vertonung aufhorchen: „Das Nashorn", eine Komposition für Kinder- oder Jugendchor, ist der jüngste von zahlreichen Kompositionsaufträgen an Harnik, die auch 2011 als Pianistin wie Komponistin tätig ist. Das Auslandsstipendium des Landes Steiermark hat sie 2010 nach Köln und Chicago geführt, außerdem nahm Harnik in diesem Jahr an der Music Omi International Musicians Residency teil, und das ORF Radio-Symphonieorchester Wien brachte im Rahmen von „102 masterpieces" die Orchesterminiatur „superschwärmen" zur Uraufführung.
Für das Haydnjahr 2009 entstand im Rahmen eines Kompositionsauftrags „schatten.risse" für Klaviertrio (UA durch das Haydn Trio Eisenstadt). 2008 war Elisabeth Harnik Artist in Residence beim 13. Komponist/innenforum in Mittersill. Dort wurden ebenfalls Zeugnisse ihrer musikalischen Auseinandersetzung mit dem Wort zur Uraufführung gebracht: „not all there" nach einem Text von Samuel Beckett (für Bariton, Bass und G-Bassett) und „wie wundersam der wind" für „Orgelgebläse betriebenes" Blockflötenconsort und Sprecher mit Orgelpfeife nach einer Auswahl mesmeristischer Texte aus dem 18. und 19. Jahrhundert.
Werner Schandor
Februar 2011
**Update 2023: Pianistin, Komponistin und Klangforscherin
„Ich bin eine Klangforscherin geblieben,", sagt Elisabeth Harnik im  „Kunstfunken"-Podcast mit Wolfgang Kühnelt anno 2022: „Ich bin nach wie vor auf der Suche nach Klangqualitäten, die das Klavier als Instrument zur Verfügung stellt - sowohl beim Komponieren als auch beim Improvisieren auf der Bühne."
„Kunstfunken"-Podcast mit Wolfgang Kühnelt anno 2022: „Ich bin nach wie vor auf der Suche nach Klangqualitäten, die das Klavier als Instrument zur Verfügung stellt - sowohl beim Komponieren als auch beim Improvisieren auf der Bühne."
Elisabeth Harnik wurde 2022 mit dem Andrzej-Dobrowolski-Kompositionspreis des Landes Steiermark ausgezeichnet. 2021 erschien ihre CD „Superstructure / Holding up a Bridge" mit zwei Kompositionen, die vom "All Ears Area Ensembles" bzw. vom Wiener Ensemble Studio Dan umgesetzt werden.
Sehr ergiebig war in den letzten Jahren auch Harniks Tätigkeit als Improvisationsmusikerin. Allein in den letzten 12 Monaten sind vier Impro-Alben erschienen:
- Im Frühjahr 2023 das Album „Vrtinci Minljivosti / Vortices of Impermanence", auf dem Harnik gemeinsam mit der slowenischen Violinistin und Performerin Ana Kravanja zu hören ist;
- im Jänner 2023 die CD „Earscratcher" mit Dave Rempis (Altsaxophon), Elisabeth Harnik (Klavier), Fred Lonberg-Holm (Cello/Electronics) und Tim Daisy (Drums/Percussion);
- im Oktober 2022 „Plasmic, live im Porgy & Bess" mit Agnes Heginger (Stimme), Elisabeth Harnik (Klavier), Uli Winter (Cello) und Fredi Pröll (Drums);
- im Juni 2022 veröffentlichte Harnik gemeinsam mit dem Schlagzeuger und Perkussionisten Zlatko Kaucic das Album „One Foot In The Air".
Ein umfassender Katalog an Aufnahmen ist der Website der Künstlerin zu entnehmen. Dort findet sich auch das aktuelle Programm der „Kunsthaltestelle Streckhammerhaus" im Gamsgraben bei Frohnleiten, die Harnik 2010 gemeinsam mit der bildenden und angewandten Künstlerin Heidi M. Richter ins Leben gerufen hat, und wo sie seither das musikalische Programm kuratiert.
Im Grazer Kulturjahr 2020 stellte die „Klangforscherin" im Grazer Augarten die wabenförmige Klangskulptur „Humming Room" vor, die auf die intensive Beschäftigung der Künstlerin mit dem „Deep listening"-Ansatz der US-amerikanischen Komponistin und Akkordeonistin Pauline Oliveros zurückgeht. Ebenfalls im öffentlichen Raum war 2016 ihre Komposition für Constantin Lusers für die TU Graz erschaffene Klangskulptur „Molekularorgel" zu vernehmen.
Kompositionen (Auswahl)
- someone will remember us (2020) für Ensemble
- Deep Call (2019) Mehrraummusik für Bläserquintett
- hollow ear (2017) für Frauenstimme, Klarinette und Kontrabass
- happiness lies within (2015) für Klaviertrio
- For B. Oulot (2014) für Ensemble (Bertha von Suttner gewidmet)
- grafting II (2013) für Ensemble
Auszeichnungen
- 2017 SKE Publicity Award Austria
- 2022 Andrzej-Dobrowolski-Kompositionspreis des Landes Steiermark
ARTfaces-Redaktion
Juni 2023