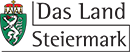Man muss die Leser foppen (*)
Universal-Artist Max Höfler plädiert für eine Literatur, die die Leser fordert.
Direkt zum *Update 2024
„Wenn man Literatur ernst nimmt, muss man sie als Kunstform betreiben und nicht nur als Geschichtenerzählen", sagt Max Höfler, seines Zeichens Autor, Musiker und Netzkünstler. Der 31-jährige Grazer ist gemeinsam mit seinem kongenialen Lesepartner, dem Komponisten Martin Pichler, einer der zur Zeit bemerkenswertesten Literaturperformer Österreichs. Gemeinsam würden sie jedes Poetry-Slam-Publikum mit ihren Auftritten zum Rocken bringen, aber mit dem Poetryslam hat Max Höfler bereits Erfahrungen gemacht, die ihm trotz Erfolgen nicht behagen: „Da geht es vor allem darum, einen auf dicke Hosen zu machen, mit ein bissl Text drumherum", meint der Autor abschätzig. Seinen Heimathafen sieht er vielmehr in den Publikationen und Veranstaltungen der perspektive. Hefte für zeitgenössische Literatur: „Als ich das erste Mal eine Lesung der perspektive besuchte, war ich sehr beeindruckt, denn es war genau das, was ich immer gesucht habe: theoretisch fundierte Literatur, formal sehr exaltiert, und Lesungen, die austeilen und lustig noch dazu sind."
Höflers eigene Texte zeichnen sich bei oberflächlicher Betrachtung vor allem durch üppige Formulierlust aus: Barocke Satzgirlanden winden sich um groß dimensionierte Erzählkonstruktionen; die äußeren Textbedingungen wie Veröffentlichungsform oder mögliche Rezeption werden als Metatext im Text ebenfalls thematisiert und bei den Performances von Höfler/Pichler als Textebenen zweiter Stufe kenntlich gemacht, indem zum Beispiel der Computer die entsprechenden Passagen liest. Eine aktuelle Arbeit Höflers, die alle genannten Merkmale aufweist, nennt sich „Texas als Textttitel". Dahinter verbirgt sich ein Work-in-progress, von dem erste Teile 2008 in der Literaturzeitschrift „perspektive" erschienen. 2010 soll der umfangreiche Text im Ritter Verlag als „Rabiatkomödienroman" veröffentlicht werden.
Kritisches Potenzial anregen
In „Texas als Textttitel" greift Höfler mehrere Themen auf, um sie durchzumodulieren. Einer der Textstränge ist um die Attentäter des US-Präsidenten Abraham Lincoln (1809-1865) angesiedelt und macht die Janusnatur historischer Geschehnisse zum Thema; ein anderer beschäftigt sich mit dem österreichischen Ethnografen Ferdinand Blumentritt (1853-1913), der auf den Philippinen verehrt wird, weil er mit dem Nationalhelden José Protasio Rizal befreundet war. Hier fließen Überlegungen zur Globalisierung und zum kulturellen Imperialismus des Westens ein. Die historischen Figuren und ihre Biografien sind für Max Höfler aber lediglich das Ausgangsmaterial - nicht um Geschichten und Anekdoten nachzuerzählen, sondern um mit der Sprache zu arbeiten. Das Ziel sind Texte, die amüsieren, aber auch verwirren. „Man muss den Leser foppen, darf ihn nicht bedienen", ist Höfler überzeugt. „Der Versteh- und Verständigungszwang in der Literatur ist Unsinn. Man muss die Leute vor den Kopf stoßen. Nur durch die Verwirrung kann man das kritische Potenzial anregen."
Um die produktive Verwirrung der Sinne unter Wahrung maximaler ästhetischer Sinnlichkeit geht es auch in weiteren Projekten Höflers, etwa der „Eigenheimgalerie" (http://eigenheimgalerie.mur.at), einer virtuellen Erzählung rund um das RAP12 (Rote Armee Partizip 1 hoch 2), wo er gemeinsam mit Nicole Lutnik ein Anzustrebendes darin sehend ist, dass das Partizip 1 ein allen Leuten zur Verwendung Nahelegendes ... äh, seiend ist. Darüber hinaus ist der 1978 in der Oststeiermark geborene und fern aller Kunstzirkel in der Nähe von Friedberg aufgewachsene Universalist seit Kurzem auch kulturbetrieblich engagiert: als Vorstandsmitglied in der Netzkunstcommunity mur.at und im Programmforum des Forum Stadtpark, wo er die Sparte Literatur mitbetreut. Dass er neben seinen Musikprojekten - „Lords of Romance", „Millsbomb" und „Doc Strayfields" - noch Zeit findet, an seiner Dissertation über eine Ästhetik in Anschluss an den späten Wittgenstein zu schreiben, zeugt zum einen von der Vielseitigkeit des Künstlers und zum anderen vom hohen intellektuellen Anspruch hinter Höflers literarischen Arbeiten, die auf den ersten Blick oft harmlos harlekinesk-verspielt erscheinen, die aber bei genauerer Betrachtung immer wieder auf das politische Generalthema Höflers ansprechen: die gesellschaftliche Bedingtheit jeglicher künstlerischer Äußerung.
Werner Schandor
Oktober 2009
*Update 2024: Alles über Max H.
„Alles über alles - oder warum" nennt sich Max Höflers bis dato jüngstes Buch, das 2023 in seinem Haus- und Hof-Verlag Ritter erschienen ist. Nach dem Vorbild von Wissens-Fragespielen a la „Trivial Pursuit" treibt er darin den Welterklärungswunsch ad absurdum. „Ein kurzweiligeres Werk ist in der experimentellen Literatur der letzten Jahre kaum zu finden", urteilte Kritiker Sebastian Fasthuber in der Wiener Wochenzeitung „Falter". Diese Einschätzung darf man ruhig auf das ganze Œuvre und vor allem auf die Lesungen und Auftritte von Max Höfler ausweiten: Gewitzter wird Literatur, die die tektonischen Bewegungen der Sprache erfahrbar macht, selten erfasst und präsentiert als vom Grazer Autor und Performer.
Der im ursprünglichen ARTfaces-Beitrag von 2009 erwähnte Buchprojekt „Texas als Texttitel" ist 2010 bei Ritter erschienen und wurde mit der Autorenprämie des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur ausgezeichnet. Fünf weitere Bücher haben seither das irisierende Licht von Höflers Literaturwelt erblickt:
- Wies is is. Ein Mondo cane-Machwerk (2014)
- Arbeit Freizeit Gewalt. Commedia (2018)
- Traktor. Das Standardwerk zur Beackerung der steirischen Kulturlandschaft (2019)
- Alternative Title: Book (London, 2020)
- Alles über alles - oder warum (2023)
Von den zahlreichen Preisen und Würdigungen seien das Rom-Stipendium des BMUKK (2011), der Theodor-Körner-Preis (2012), der Peter-Rosegger-Literaturpreis des Landes Steiermark (2012), den Rotahorn-Literaturpreis 2024 und das Kaffeehausliteratur-Stipendium der Zeitschrift „manuskripte" 2024 erwähnt. Letzteres wurde ihm in Würdigung seiner „begnadeten" Literaturperformances gewährt. Das Wort ist nicht zu groß gewählt, denn in seinen Auftritten erbringt Höfler in der Nachfolge von großen Meistern wie Ernst Jandl den Beweis, dass Sprachspiele und Literaturexperimente nicht nur unterhaltsam, sondern wirklich lustig sein können. Auch ORF-Literaturdoyenne Katja Gasser schrieb über „Alles über alles": „Das lustigste Buch der Saison! Oder ist es vielleicht nicht vielmehr so, dass es das komischste des Jahres ist? Das vielleicht allerwitzigste von allen je?" - Hm. Vielleicht nicht das allerwitzigste, aber sicher das aberwitzigste seit Langem.
Werner Schandor
Oktober 2024