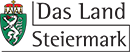Jazzmusiker mit ethnischen Beziehungen (*)
Improvisator Stefan Heckel zeigt keine Berührungsangst vor der weltweiten Volksmusik
Direkt zum *Update 2024
Man muss ja als akademisch ausgebildeter Jazzmusiker nicht immer gleich nach New York oder Boston gehen, um mit der Erleuchtung heimzukehren, dass die Sache mit dem Jazz keine leichte ist. Vor allem dann, wenn man als kreativer Musiker den bescheidenen Wunsch hegt, davon leben zu wollen. Sozusagen als Künstler. Es genügt freilich auch das teure London, wohin es weiland auch den Pianisten Stefan Heckel zog, um schwer über die Runden zu kommen, hart arbeiten zu müssen. Fruchtlos blieb das im Fall Heckel freilich nicht. Der gebürtige Grazer, der an der Royal Academy of Music Jazzkomposition studiert hat, nahm 1998 in London seine erste CD auf. „Horch" nannte er interessanterweise sein Platten-Debüt mit der Stefan Heckel Group, vielleicht auch deshalb, um im Hörer die Frage nach dem Unterschied zwischen hören und horchen zu provozieren. Oder um zu philosophieren, warum Musik keine Frage des guten Geschmacks, sondern eine der Erkenntnis ist. Selbstredend, dass Kontakte aus seiner Londoner Zeit übrig geblieben sind, wie etwa zum virtuosen Saxophonisten Julian Argüelles, der noch heute das Format dieser Band wesentlich mitbestimmt.
Für den Pianisten und Komponisten Stefan Heckel führt seit seiner Zeit in London kein Weg mehr an der Improvisationsmusik vorbei. In all seinen Projekten und Kompositionen steht die Freiheit im Zentrum eines kreativen Prozesses, der sich in einem konkreten Rahmen stets neu definiert. Vom Jazz bis zur Neuen Musik. „Die Improvisation", sinniert der seriöse Klangforscher, „ist ja überhaupt die Wurzel aller Musik". Längst ist Heckel, der heuer 41 Jahre alt geworden ist, wieder in seine Heimat zurückgekehrt, zumal ihm ein Angebot für eine Unterrichtsstelle an der Jazzabteilung der Kunstuniversität Graz (KUG) diese Entscheidung nicht gerade erschwert hat.
Stefan Heckel wäre nicht der seriöse Musiker, den wir als neugierigen Tonsetzer kennen, sähe er nicht auch in der Lehrtätigkeit mehr als bloß die Sicherung einer guten Existenz. Vor allem an den Jungen merke er, wo er selber stehe und dass das Unterrichten „ein wirkliches Im-Jetzt-Sein" bedeuten kann. Mehr noch, „jeder Unterricht ist wie eine Performance", bringt es der besonnene Charakterkopf mit einem Wort des Bassisten Adelhard Roidinger auf den Punkt.
Damals vor zehn Jahren, als Heckel plötzlich wieder in der heimischen Szene auftauchte, meldete er beim Grazer Jazzclub-Festival und beim „Austrian Soundcheck" auch gleich seine Vorstellung einer offenen, klangorientierten Musik an. Und man wusste, dass fürderhin sein Weg über das Ohr und nicht über die Noten führen wird. Mittlerweile gibt er diese Erkenntnis auch an seine Studenten weiter, die der sogenannte Wahlwiener an der KUG in Gehörschulung und Arrangement ausbildet.
Bemerkenswert scheint auch, dass der Jazzmusiker Heckel seit jeher auch ein gewisses Naheverhältnis zur Volksmusik pflegt. Nicht nur zur heimatlichen, sondern beispielsweise auch zu fernöstlichen Idiomen, wenngleich man das heutzutage ja eher als Worldmusic bezeichnet. In einem ganz unkonventionell besetzten Trio mit seiner Frau, der Fagottistin Maria Brigitte Gstättner, und dem marokkanischen Percussionisten und Sänger Aziz Sahmaoui werden etwa steirische Volkslieder mit nordafrikanischer Musik voller Leidenschaft zusammengeführt. Zurückzuführen ist dieses Naheverhältnis wohl auf seine Zeit als Harmonikaspieler, in der klein Stefan sehr der alpenländischen Volksmusik zugeneigt war.
Im Quartett Mélange Oriental, einem seiner aktuellen Hauptprojekte, geht es gleich mehrfach um ethnische Musik, nämlich jener aus den vier Vierteln der Altstadt Jerusalems, dem jüdischen, armenischen, muslimischen und christlichen. Wobei der Pianist diesfalls am Akkordeon zu hören ist. Und auch die Arrangements liefert.
Sein Stammprojekt, die Stefan Heckel Group, die er eigentlich schon 1995 bei einem Workshop in Kanada gegründet hat, bleibt indes die kreative Keimzelle des an der Grazer KUG diplomierten Jazzpianisten. Damit hält er im Jahr 2010 bei drei CD-Veröffentlichungen. Mit welchen Namhaftigkeiten Stefan Heckel in seiner Laufbahn zusammengespielt hat, welchen Einladungen er folgte und welche Kompositionsaufträge er erhalten hat, ist letztlich nicht mehr als biografischer Ballast, der nur die Sicht auf einen aufgeweckten Musiker und einen Unentwegten verstellen würde.
Otmar Klammer,
September 2010
*Update 2024: „Kunst hat Einfluss auf die Gesellschaft“
Die Vermittlungsarbeit des Jazzmusikers, Komponisten und Universitätslehrenden Stefan Heckel geht weit über die Dimension musikalischer Fähigkeiten hinaus. Das Kommunizieren, das Hören und Zuhören, das Improvisieren, aber auch die gesellschaftliche Rolle von Musikerinnen und Musikern stehen im Fokus seiner Lehrtätigkeit. 2024 wurde er mit dem Nikolaus-Harnoncourt-Stipendium des Landes Steiermark ausgezeichnet.
Herzliche Gratulation zum Nikolaus-Harnoncourt-Stipendium! Was bedeutet diese Auszeichnung für dich?
Es ist eine große Freude und Ehre für mich, und es hat mich sehr berührt, weil ich vor etwa 25 Jahren beim Projekt „Musik zum Anfassen" mitgewirkt habe - das war ein Vermittlungsprojekt unter der Schirmherrschaft von Nikolaus Harnoncourt. Damals haben wir in einer Berufsschule in Linz mit Metallbau-Lehrlingen Klanginstallationen gebaut. Da das Harnoncourt-Stipendium für die „musikalische Bildung junger Menschen" vergeben wird, habe ich mich gut abgeholt gefühlt. Es war ein sehr schönes Signal und eine Aufmunterung zum Weitermachen.
Du unterrichtest an der Kunstuniversität Graz (KUG) und an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien (MDW). Welche Fächer deckst du ab?
Meine Lehre findet hauptsächlich an der KUG statt. Ich unterrichte unterschiedliche Fächer im Bereich Ensemble, Improvisation, Gehörschulung und in den letzten Jahren vor allem im Bereich Artistic Citizenship. Ganz konkret: Wir haben ein Projekt, bei dem ich mit Studierenden auf eine Krebsstation gehe, wir bieten dort eine Woche lang Musik für schwerkranke Patientinnen und Patienten an. Zurzeit spielen wir auf der Hämatologie an der Uniklinik Graz. Im kommenden Studienjahr spielen wir auf der Station für Psychiatrie
Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten stehen im Zentrum deiner Unterrichtstätigkeit?
Es geht um drei wesentliche Punkte: 1.) Kommunizieren lernen innerhalb der Musik, aber auch außerhalb der Musik. Das hat viel zu tun mit 2.) Hören und Zuhören - auch weit über die musikalische Gehörschulung hinaus verstanden. Und 3.) die musikalische Improvisation: Ich vermittle den Studierenden, abseits des Notenblattes selbst spontan Musik zu generieren, weil es eine hohe Zufriedenheit schafft und die jungen Künstlerinnen und Künstler berufsfähig macht. Das Berufsfeld ändert sich, und den reinen Interpreten, die reine Interpretin, gibt es nicht mehr in großer Anzahl. Daher ist es für mich eine Frage der Verantwortung gegenüber der jungen Generation, die Fähigkeit des Improvisierens zu vermitteln.
Hat sich der Zugang zur Musik, den die Studierenden heute haben, seit deiner eigenen Studienzeit geändert? Und hat sich der didaktische Ansatz seit deiner Studienzeit geändert?
Dazu fällt mir sofort der digital shift, also die digitale Durchdringung nahezu aller Lebensbereiche ein. Auch Musik und Musikausbildung sind heute davon geprägt. Die heutigen Studierenden gehören zur ersten Generation, die mit der scheinbar vollkommenen Verfügbarkeit von Daten erwachsen geworden ist. Wir reden hier vom Zugang zu Quellen, aber auch vom Musikhören. Diese Verfügbarkeit hat Vor- und Nachteile: Ein klarer Vorteil ist der schnelle Zugang zu Tonaufnahmen aus mehr als einem Jahrhundert von Geschichte und Gegenwart der Musik. Nachteile sind vor allem die abnehmende Qualität des Klanges im Bereich des digitalen Streamings und der recht achtlose Umgang mit Daten.
Die Pädagogik hat sich in meiner Wahrnehmung insgesamt deutlich verbessert, und die Didaktik, die ich in meinem Umfeld erlebe, ist heute Studierenden-zentriert. Und ein weiterer Punkt: Künstlerinnen und Künstler werden als wichtige Proponenten der gesellschaftlichen Veränderung wahrgenommen. Kunst kann aus meiner Sicht nicht nur für sich selbst existieren, sie hat Einfluss auf die Gesellschaft und soll diese Verantwortung auch übernehmen. Das geschieht natürlich bereits seit Kunst als solche wahrgenommen wird, doch hier geht es um einen Perspektivenwandel in der aktuellen Musik- und Kunstausbildung. Ohne zu konkret werden zu wollen: Musik ist nicht Krieg, sondern es ist etwas, das - häufig ohne Worte - zur Verständigung beitragen und Kommunikation ermöglichen kann.
Auf deiner Website steht unter der Rubrik „Teaching" unter anderem ein Zitat von Konfuzius: „Die Prozesse des Lehrens und Lernens befruchten sich gegenseitig." - Warum hast es ausgewählt? Was bedeutet es für dich?
Wenn ich in meiner Erfahrung als Lehrender auftrete, dann bin ich meistens in einem Vermittlungsmodus, aber gleichzeitig auch in einem empfangenden Modus, und das ist der Teil, wo ich als Lehrender auch lerne. Lehren bzw. Unterrichten ist immer ein Austausch mit unterschiedlichen Verantwortungen: Es gibt einen oder eine, der oder die die Vermittlung führt, vorbereitet und etwas vorschlägt, und es gibt die Lernenden, die das dann hoffentlich annehmen oder auch nicht und sich dazu äußern. Am Ende dieses Prozesses bzw. einer Lehreinheit haben die Lernenden etwas gelernt, und ich habe hoffentlich etwas gelehrt, aber ganz sicher haben auch die Lernenden mich etwas gelehrt ... Leonard Bernstein bezog sich in einem Interview zu Musikunterricht auf die klangliche Ähnlichkeit der deutschen Wörter „Lernen" und „Lehren". In der deutschen Umgangssprache heißt es manchmal: „Ich lerne Dir etwas" (O-Ton Bernstein: „I'll learn you something") Bernstein spielte damit wohl auf die Bedeutung des Lernens und Lehrens als Prozess in beide Richtungen an.
Wie beeinflusst deine Arbeit als Hochschuldozent dein eigenes künstlerisches Schaffen? Gibt es da einen Austausch?
Gute Frage. Was würde Konfuzius dazu sagen? Die Antwort liegt vermutlich in meiner Musik: Man könnte sich mein erstes Album von 1998 anhören: „Horch", ein Jazz-Album, wo ich frisch nach der Ausbildung versucht habe, das, was mir dort aufgegangen war, musikalisch abzubilden. Mein jüngstes Album ist im September dieses Jahres erschienen. „The Field Organ Project. Stories Against War", folgt einem vollkommen anderen Konzept und präsentiert frei improvisierte Musik unter Verwendung der Lyrik von Bertolt Brecht, Dylan Thomas und Erich Fried, eingelesen von Daniel Doujenis - und es ist durchaus eine Stellungnahme zu den aktuellen Ereignissen, aber mehr wie eine Imagination, und keine Programmmusik.
In den letzten 25 Jahren ist mir auch durch das Unterrichten immer stärker klargeworden, was meine Rolle als Lehrender sein kann, und es wäre schizophren, wenn das nicht in meine Kunst einfließen würde. So wie meine Erfahrungen als Musiker den Unterricht berührt haben, hat auch das Unterrichten meine musikalische Arbeit berührt. Ja, der Austausch findet statt!
Kurzbio Stefan Heckel
Stefan Heckel, geboren 1969 in Graz, ist Jazzmusiker (Piano, Akkordeon, Komposition), der auch im Bereich der World Music arbeitet. Er studierte an der Kunstuniversität Graz Jazzklavier und Instrumentalpädagogik (IGP) und an der Royal Academy of Music London Komposition. Er gründete mehrere Ensembles, u. a. die Stefan Heckel Group, mit der er vier Alben mit eigenen Werken aufnahm. Zuletzt erschienen „Lammfrom" (2020) mit Erich Oskar Huetter und dem Dichter Franzobel, „Instants. Piano solo" (2023) und „The Field Organ Project. Stories Against War" (2024) mit Zvezdana Novakovic (Gesang), Tin Dzaferovic (Bass), Nikola Vukovic (Trompete), Alex Yannilos (Drums), Stefan Heckel (Harmonium) und Daniel Doujenis (Sprecher)
Werner Schandor
Stand: September 2024