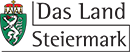Ein Beobachter und seine Umlaufbahn (*)
Wendelin Pressl als künstlerischer Feldforscher par excellene
Es sind die kleinen Dinge. „Ich glaube, man sieht irgendetwas, das man umformen möchte, um so seine Bedeutung zu verschieben". Das ist die Idee. In der Umkreisung und Umsetzung konveniert sie wie von selbst in ein größeres Ganzes der Auseinandersetzung. Das ist das Feld. Wenn Feldforschung Beobachtung und Befragung im natürlichen Kontext, im Alltagsleben, über Verhältnisse in der Wirklichkeit meint, so ist es genau dieser Vorgang. Der Spürsinn des Künstlers erstreckt sich in alle Richtungen. Die Entdeckung eines Phänomens reizt die künstlerische Sammelleidenschaft, seine Umdeutung, das Zerlegen in die Bestandteile und deren Neukombination befördern diese Transformationen ins Kunst-Universum. Wenn auch das Kategorisieren, die Typenbildung Gegenstand der Feldforschung ist, ist Wendelin Pressl ein Feldforscher par excellence. Denn es gibt etwas, das sich durchzieht. Zwei Konstanten rund um die Fotografien, Malereien, Zeichnungen, Collagen, Objekte, Installationen, Videos, Aktionen, die erstaunlicherweise geometrischer Natur sind: Linie und Kreis.
Das weiße Feld und das Chaos
Zuerst die Linie: Als landläufiger Zebrastreifen im öffentlichen Raum, dessen Ordnung und Regelbehaftetheit von Wendelin Pressl an die pure Verwirrung ausgeliefert wird, wenn er ein Durcheinander an Streifen vom Experimentierfeld Leinwand auf der Straße anbringt. Oder im Video, wenn ein Passant im konträr zum Bodenbelag gestreiften Sakko für eine wandelnde visuelle Karierung der Straße sorgt. Im eigenen Chaos verstrickt scheinen die Zebrastreifen in den Bildern beinahe wie abstrakte Teilchen im Mikroskop des Künstlers, deren Ordnung es erst zu erforschen gilt. Erste Ansätze gibt es bereits: „Der Kreis und das Feld sind verwandt" lautet einer der Bildtitel. Wirrwarr als formaler Kulminationspunkt ergibt sich oft auch sehr zufällig - in gefundenen Strukturen. So ist des einen Hindernis, wenn der Blick in die famose Kuppel des Pantheons mit einem Gerüst verstellt ist, des Pressls Freude, weil genau dieses Moment Gelegenheit zur Observation eines ephemeren Licht- und Schattenspiels bietet.
In Betrachtung der Weltraumbetrachtungsmaschine
Ähnliche Tragwerkskonstruktionen waren es auch, die Wendelin Pressl nach Effelsberg lockten. Das vollschwenkbare Radioteleskop, entdeckt in einem Buch über technische Wunder aus den 1970ern, kann nämlich mit einem einzigartigen Gerüst-Wirrwarr aufwarten. In einer Fotoserie inszeniert er sich als Betrachter dieser Maschine zur Weltraumbetrachtung. Aber um zu den kleinen Dingen zurückzukommen: Vom Besuch in Effelsberg brachte er auch eine triviale Kostbarkeit mit, die für seine Arbeit umso mehr wiegt. Ein Souvenirtellerchen mit dem Effelsberger Teleskop wird als Apparatur selbst in automatische Drehbewegung versetzt und scheint für sich wiederum den Himmel abzutasten - vom Porzellanschrank aus.
Die Vermessung der Welt
Und doch ist die in Effelsberg eingesetzte Technik objektiver Himmelsbeobachtung für den Laien kaum nachvollziehbar. Den berühmten Bildern fehlt zum allgemeinen Verständnis ein greifbares Bezugssystem. Für seine Serie vom „Hubble Deep Field" greift Wendelin Pressl zum Zeichenstift und malt sich seine eigenen interstellaren Bilder, die im Leuchtkasten perfekt in Szene gesetzt diesen scheinbar objektiven Blick hinaus in die Tiefen des Weltraums ins Wanken bringen. Die Arbeit „Delirious" enttarnt dagegen die virtuelle Bildproduktionsmaschinerie von Google Earth und ihre unangezweifelte Genauigkeit in der Realitätsabbildung, die Häuserfluchten in unperspektivischer Weise zusammenlaufen lässt. Pressl exerziert diesen Irrtum anschaulich im Kartonmodell. Bei „Airlines" und „Loop" war indes die künstlerische Beobachtung noch mit dem freien Auge möglich. Fotos von weißen Kondensstreifen arrangieren den internationalen Flugverkehr zur Kreisform oder kaschieren ihn auf die verkleinerte Kuppel des Pantheons zu einem Objekt, das wie in den Facetten einer Discokugel den Himmel selbst zigfach zu spiegeln scheint.
Von Circus Maximus und Brot und Spielen
Ein weiteres Wahrnehmungs-Feld spannt „Circo Maximo" auf. In Annäherung an die römischen Wagenrennen werden Autos auf der Abbiegespur gefilmt - mit vier Fernsehern, als Kreuzungssituation aufgestellt, ergibt sich so ein stetiges Kreisen und ein ungehöriger Lärm. Im umgekehrten Fall schneidet die Form des „Circus" sich als Collage in den Wiener Stadtplan. Im Zusammendenken all dieser Arbeiten entstehen universelle Ausstellungsideen und Arbeitszyklen. So nimmt „Luna Park" als Idee auf das Vergnügungsterrain auf Coney Island Bezug und konstruiert sich mit verschiedensten „Komponenten" wie Astroland, Waterworld, Rollercoaster oder „Barrel of Love" zu einem Rummelplatz der anderen Art. Es gäbe noch viel zur erzählen - zum Beispiel von Brot und Spielen, wenn Spaghetti mit Acrylfarbe zu Mikadostäbchen oder Pizzakartons zu aufklappbaren Triptychen der Fernsehübertragung werden („Panem et Circensis"), von schwimmenden Haiflossen, dem Puzzle-(Turm-)Bau zu Babel oder den Umwegen, die ein Gerüst als angeblich abgekürzte Zugangsform zur Galerie bedeuten kann („Abbreviation").
Kontakt:  www.wendelinpressl.com
www.wendelinpressl.com
Eva Pichler, Mai 2010
Wendelin Pressl beschreibt in einem Satz seinen künstlerischen Werdegang in etwa so: „Ich habe Malerei studiert und mich dann aber immer mehr davon entfernt (...) und bin so zum Basteln gekommen." Der Begriff Kunst sei ihm zu schwer und zu umfassend, auch die Berufsbezeichnung eines Bildhauers trifft seine Arbeit nicht exakt genug oder schubladisiert sie zu sehr. Objektkunst ist der größte gemeinsame Nenner der Vielseitigkeit, die seiner künstlerischen Arbeit immanent ist. Die kreativen Ideen, deren Form und Inhalt einander bedingen, kommen auf verschiedene Art und Weise zustande: „Mir fällt etwas auf, sei es eine politische, soziale, gesellschaftliche oder ironische Problematik", sagt Pressl. Diese Idee werde dann in einem Reflexions- und Transformationsprozess auseinandergenommen und untersucht und in einen neuen Kontext mit eigenständiger künstlerischer Aussage gesetzt. Seine Projekte seien lesbar wie eine neue Erfindung. Und Humor dient Pressl als Trägermedium: mit feinem Augenzwinkern gibt er den BetrachterInnen die Chance, lustvoll hintergründige Ironie zu erkennen. Pressls Zugang: „Mir ist es lieber, die BetrachterInnen mitzudenken, als das Kunstwerk nur auf sich selbst referenzieren zu lassen."
Pressl versetzt in seinen Werken Dinge in eine neue Ordnung, in eine andere Struktur und lässt gleichzeitig viele Gedanken offen schweben - je nach Betrachtungsweise sind diese auch jedem selbst überlassen.
Ein wichtiges Thema in seinen Arbeiten bleibt das Universum mit möglichen Unterkapiteln wie Ordnungssystemen, Sicherheit und Angst, Fälschungen oder Wahrheit - und immer ist auch das Scheitern inbegriffen, weil das Universum am Ende angenehmerweise doch unfassbar bleibt.
Für seine Arbeit „Apparate zur Betrachtung der Oberfläche des Mondes" hat Pressl aus Karton gebastelte Schachteln inklusive Guckloch an die Wand montiert. Der Blick nach innen ermöglicht den BetrachterInnen, auf eine Mondoberfläche zu sehen. Das Auge nimmt eine grauweiße löchrige Oberfläche war. Eigentlich schaut der Betrachter „nur" auf die Wandstruktur, die durch Licht, das durch einen schmalen Spalt in die Schachtel dringt, sichtbar gemacht wird.
Pressl spielt mit Assoziationen, Referenzen und eben auch Irritationen.
Für einen kleinen Hamburger Kunstverein mit einem Ausstellungsraum im Bauch eines Kutters ist die Arbeit „Die Kimm" (=die sichtbare Grenzlinie am Meer zwischen Himmel und Erde) entstanden. Dafür hat sich Pressl „Seestücke" anonymer Maler aus dem Internet geholt, ausgedruckt und auf Holzplatten befestigt und zu einer Art Panorama in Augenhöhe montiert: Die geschlossene runde Anordnung dieser Bilder ist immer auf die gemeinsame Horizontlinie ausgerichtet. Die BetrachterInnen tauchen von unten in dieses Rondeau ein, um dann allein, dieses heterogene Meer auf sich wirken zu lassen.
Im Frühling 2016 war der 45-jährige Künstler als Artist-in-Europe des Landes Steiermark drei Monate lang in Brüssel zu Gast. Für ihn selbst ist ein Residenz-Aufenthalt eine Form von Ausnahmezustand. Der Aufenthalt suggeriert ein großes Maß an Freiheit, dem jedoch der eigene künstlerische Druck im Wege steht: „Man ist sich hierbei nicht immer nur der größte Freund." Man sei jeden Tag auf der Suche nach der großen Entdeckung und doch lebt man in der Großstadt immer in einem Halbschatten und sei fast inexistent. Durch das Alleinsein und auf Sich-gestellt-sein entwickelt sich aber auch ein sehr produktiver Zustand.
Die Ergebnisse werden ein Pressl-Projekt sein, in dem er seine Ideen wieder einer Verfremdung unterzieht, und ihnen in einem neuen Kontext eine neue Verwendung gibt.
Sein Leben als Künstler bestreitet er durch einen Mix aus Projekten, Auftragsarbeiten, Ankäufen und Förderungen.
Man darf gespannt sein, wo uns Pressl aufs Neue sein unendliches Universum präsentiert.
Petra Sieder-Grabner, August 2016
Wendelin Pressl
geboren in Graz (1971), lebt und arbeitet freischaffend in Wien;
Studium an der Meisterschule für Malerei, Graz (1993) und an der Akademie der bildenden Künste Wien (2000); zahlreiche Studienaufenthalte und Residencies wie u.a. in Rom (2004), Budapest (2005), Petömihályfa (2012), Judenburg (2012), Tirana (2013) und Brüssel (2016);
Kunstförderungspreis der Stadt Graz (2009) und Staatsstipendium für bildende Kunst (2011);
Diverse Projekte im öffentlichen Raum wie u.a. REVUE (2010, Fritz-Grünbaum-Platz Wien), Paradise Lost (2011, Leechkirche Graz), Meisterstück (2014, Salzburg), Altarzone Frauenberg (2014, Steiermark) oder Kulturhaus/Heimatmuseum Strasshof (2014, Niederösterreich);
Zahlreiche Ausstellungen, u.a. Galerie 5020, Salzburg - Kunstverein das weisse haus, Wien - Galerie Cortéx Athletico, Bordeaux - kunsthaus muerz, Mürzzuschlag - Museum für angewandte Kunst, Wien - Museum für Gegenwartskunst Stift Admont; - TAF, Athen - Neue Galerie, Graz - Kulturzentrum bei den Minoriten, Graz - artachment, Basel - Galerie Eugen Lendl, Graz - Action Field Kodra, Thessaloniki - Künstlerhaus, Wien - rotor, Graz - Galerie GefängnisLeCarceri, Kaltern - Galerie IG Bildende Kunst, Wien - Krinzinger Projekte, Wien - 21er Haus, Wien - Galeria FAB, Tirana - La 56. Biennale di Venezia.
Werke in öffentlichen Sammlungen wie u.a. Artothek des Bundes, Sammlung Kulturamt Graz, Artothek und Sammlung der Stadt Wien, Universalmuseum Joanneum Neue Galerie Graz, Verein der Freunde der Bildenden Künste Wien, Museum für Gegenwartskunst Stift Admont
2007 erschien bei Schlebrügge.Editor die Monografie CIRCVS MAXIMVS und 2010 beim Verlag Bibliothek der Provinz die Projektpublikation Dort wo ich nicht bin, dort ist das Glück.
Die aktuelle Publikation LUNA PARK erschien 2015 bei Revolver Publishing Berlin