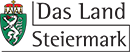Die geschrumpfte Heimat
Ursula Wiegele und ihr Debütroman „Cello, stromabwärts"

Wenn man jemanden nicht kennt, ist die Versuchung groß, ihm oder ihr eine erfundene Biographie in die Wiege zu legen. Zu Ursula Wiegeles Debütroman „Cello, stromabwärts" (Drava, 2011) würde ein Migrationshintergrund der Autorin gut passen. Und dass sie das Buch in einem Anhaltelager verfasst hätte. So sehr haben wir uns an eine autobiographische Lesart gewöhnt. Doch leider müssen wir bei der Wahrheit bleiben: Ursula Wiegele wurde 1963 in Klagenfurt geboren und lebt in Graz. Sie hat in Österreich und Italien Philosophie studiert, war Lektorin und ist heute neben ihrer schriftstellerischen Arbeit im Sozialbereich tätig. Sie hat mehrere Preise bekommen und 2012 das österreichische Staatsstipendium für Literatur erhalten.
Die Rezensionen ihres Romans hätten hauptsächlich aus Paraphrasen auf den Klappentext bestanden oder gleich aus Zitaten daraus, beklagte sich die Autorin bei einer Lesung. Darum lassen wir den Klappentext seine Klappe schließen. Auch wenn er von der gelernten Lektorin Wiegele selbst verfasst worden sein könnte. Der Schauplatz des Buches: ein Haus voller Musik, voller Künstler und Kunstliebhaberinnen. Das Haus steht in einer österreichischen Stadt, bei der es sich um Graz handelt. Die Zeit: unsere Gegenwart. Also gibt es zur Streichmusik kein Idyll. Heiter ist die Kunst, lustig geht es auch bei den Hausfesten zu, aber ernst bis tragisch ist das Leben der Künstler, die es aus dem Osten Europas nach Österreich verschlagen hat. Ihre Lebensverläufe, Lebensverirrungen werden hier eingebettet in einen Fließtext, der donaustromabwärts führt. Das ließe sich nacherzählen. Aber das könnte dann leicht nach einem Klappentext klingen. Auch ist die inhaltsfixierte Auseinandersetzung mit Literatur fast so verhängnisvoll wie der Zwang, autobiographische Bezüge erkennen zu wollen.
Da Texte aus Sätzen bestehen - auch solche, die an der phantasmatischen Methode des Geschichtenerfindens und der psychologischen Charakterdarstellung festhalten - einige Zitate, nebst Anmerkungen dazu:
„Wer sich weigert, die Suppe zu essen, lässt die Heimat schrumpfen."
Die rumänische Flecksuppe (ciorba de burta) unterscheidet sich von der altsteirischen Kuttelflecksuppe mehr im Namen als in den Zutaten. Für die Länder gilt diese Analogie nicht. Die Heimat ist fast gegessen, ihr Speiserest ein globales Dorf, kein Ort, wo noch niemand war, sondern ein Un-Ort, wo niemand wirklich sein kann.
„Ein Leben voller Synkopen"
In der Medizin ist die Synkope ein Kreislaufkollaps, in der Musik erzeugt sie durch die Verschiebung der regulären Taktordnung rhythmische Spannung, im Leben ist sie das Muster, das taktlos Erwartungen enttäuscht.
„Dein Körper schmeckt nach Fichtenholz und dein Hals nach Ahorn."
Das Cello hat weibliche Rundungen, die Gambe einen Frauenkopf am Steg. Auf den Körpern lässt sich nicht nach Belieben spielen, darum greift der Musiker nach den Instrumenten, will ihnen die Töne entlocken, die sein Innenohr verbirgt.
„Einen Teil von sich selbst noch im Traum"
Da sich für den Schauspieler Bogdan mit der eingeborenen Zunge, seinem „Zungenbelag" genannten Akzent in der Fremde kein Kapital erspielen lässt, müssen die Engel in den Kirchen dran glauben; diese Wesen, die es augenscheinlich nicht gibt, bringen ihrem ehrlichen Dieb dennoch gutes Geld. Bis sich ein leibhaftiger Engel im Rausch verplappert.
„Poesie ohne Worte"
Auf dem Weg dorthin liegen noch viele zusammengesetzte Worte, die das Fremde übersetzen, denn das Fremde will sich mit dem Eigenen teilen in diesem Text und seinem musikverwandten Strömen, zu singen beginnen möchte er mit der Stimme von Ursula Wiegele ...
Günter Eichberger
Februar 2013