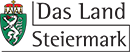Paparazzi-Fotografie als Kunstform
G.R.A.M. stellen das Verhältnis der Kunst zur medialen Wirklichkeit mittels re-inszenierer Bildikonen infrage.
G.R.A.M. sind eine österreichische Künstlergruppe, die 1987 von Martin Behr, Günther Holler-Schuster, Ronald Walter und Armin Ranner in Graz gegründet wurde. Kennengelernt haben sich die vier beim Kunstgeschichte-Studium, unter dem Label G.R.A.M. präsentierten sie anfangs ausschließlich Einzelarbeiten. Mittlerweile bestehen G.R.A.M. aus Martin Behr und Günther Holler-Schuster, deren Gemeinschaftsarbeiten die vielleicht schillerndsten Beispiele für die jüngere Grazer Kunst darstellen.
Die erste G.R.A.M.-Ausstellung fand 1987 in einer leerstehenden Wohnung statt. „Das darf man sich aber jetzt nicht wie einen White Cube vorstellen, sondern da standen auch noch überall Schutthaufen herum", so G.R.A.M., aber trotzdem sei die Ausstellung stimmig gewesen. Die Musik für den Abend kam übrigens von Robert Stolz, und zu trinken gab's viel Bier. Aber sehr bald merkten G.R.A.M., dass die autodidaktische Malerei Grenzen aufzeigt. „1991 machten wir unsere erste Installation, das war ein Motorrad auf einem Bühnengerüst." Zugleich entwickelten sie ihr Faible für neue Techniken: „Damals war der Farbkopierer neu auf dem Markt und wir machten erstmals eine Bearbeitung aus bestehenden Bildern." Immerhin wurden die Arbeiten in der Landesgalerie Linz in der Gemeinschaftsausstellung „Copy Art" sowie als Einzelausstellung in der Neuen Galerie Graz, damals noch unter der Leitung von Wilfried Skreiner, gezeigt.
1997 war das erste wirklich große Jahr von G.R.A.M. Für ihr Paparazzi-Projekt bekamen sie das MAK-Schindler-Stipendium in Los Angeles. „Wir haben dort unbekannte Menschen und echte Stars in der Paparazzi-Ästhetik fotografiert." Die Fotos wurden in den Ausstellungen vermischt. „Wir haben, um diese künstlich erzeugte Paparazzi-Ästhetik zu erreichen, die Aufnahmen aus einem Versteck heraus fotografiert, wo zum Beispiel der Winkel zum Fotografieren sehr ungünstig ist." Von Johnny Depp bis zu Jack Nicholson bekamen sie viele „alte Helden" vor die Linse. Natürlich auch Kuriositäten, wie Baywatch-Star David Hasselhoff. „Mit der Zeit entwickelt man einen wissen Ehrgeiz und es war auch spannend, da es damals keine Digitalfotografie gab. Da drückt man zum Beispiel bei einer Ausstellung einmal ab und das muss dann passen." Dazu verwendeten sie verschiedene Kamera-Typen, von der Spiegelreflexkamera mit Teleobjektiv bis zur Wegwerfkamera. Durch den Tod von Lady Diana auf der Flucht vor Paparazzi wurde die Paparazzi-Fotografie unerwartet zum tagesaktuellen Thema. „Das hat uns einige Ausstellungen gekostet, weil Galeristen Angst hatten, mit dem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen, aber im Grunde war die Thematik dadurch aktueller als zuvor, also war es kein Schaden." In Cannes und Nizza wurde das Projekt fortgesetzt. Und die „Nachwirkungen" sind bis heute spürbar: 2013 werden G.R.A.M. zu einer Gemeinschaftsausstellung in die Centre-Pompidou-Außenstelle in Metz eingeladen.
Nicht zu vergessen sind die G.R.A.M.-Videos. „Wir kommen ja aus der Videoclip-Generation. Videos zu machen ist da selbstverständlicher, als zu malen oder zu zeichnen." Als Thema wählten sie „Kunststücke aus dem Alltag", sogenannte „Special Effects": „Bierdeckelrekorde; mit Maggiflaschen schreiben oder die Messer-Finger-Spiele halt." Alles was man macht, wenn man im Wirtshaus einige Stunden zu lange bleibt und die Fadesse einen überkommt. Eine Auslotung der Möglichkeiten fand statt. Was ist Kunst? Wie trivial darf sie sein? Und überhaupt: Darf Kunst Spaß machen? G.R.A.M. sagen ja.
Irgendwann kommt jeder Paparazzo in die Krise, dann muss er sich nach Neuland umsehen. G.R.A.M. hatten Glück, sie fanden Gefallen daran, sogenannte Nachstellungen für sich zu interpretieren: „Als erstes Projekt stellten wir bekannte Szenen aus den Stummfilmen von Laurel & Hardy in Form von fotografierten Standbildern nach." Zu sehen sind hier tortenschlagverschmierte Gesichter, brennende Daumen oder Laurel & Hardy, die vor einem Ziegelscherbenhaufen sitzen. Meistens sind es Momentaufnahmen nach der Katastrophe, im Moment des Denkzettels. Danach stellten G.R.A.M. Aktionen der Wiener Gruppe nach. „Wir orientierten uns an Aufnahmen, die wir in Zeitungen oder Katalogen gefunden haben. Aber auch hier haben wir versucht, jeglichen Witz zu vermeiden und mit pathetischem Ernst zu arbeiten." Das gibt den G.R.A.M.-Nachstellungen eine Tiefe und hinterlässt beim Betrachten eine sonderbar desillusionierende Stimmung.
Bis heute stellen G.R.A.M. „Medienbilder" nach, die sich in den Köpfen der Menschheit festgesetzt haben, wie zum Beispiel das berühmte Bild von den Olympischen Spielen in München 1972, wo ein palästinensischer Terrorist mit Maske auf dem Gesicht vom Balkon eines schnöden Betonbaus schaut. G.R.A.M. re-inszenierten diese Situation in der Grazer Eisteichsiedlung. Das Resultat ist auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich. „Das letzte Bild, das wir nachgestellt haben, war die Parlamentsrauferei in der Ukraine, die hat ja bereits auf dem Zeitungsfoto eine Gemäldestruktur."
Als Nächstes solle die Nachstellung einer Massenszene aus dem Film „Doktor Schiwago" in Moskau erfolgen. „Die wurde genau dort gedreht, wo sich heute die Österreichische Botschaft befindet. Die Botschafterin in Moskau ist Frau Margot Löffler. Sie wird auch Teil vom Bild sein, so wie alle Personen, die in der Botschaft arbeiten. Wie wir das genau bewerkstelligen werden, wissen wir noch nicht genau, aber die Sache wird sicher gut werden!"
Martin G. Wanko
Stand: Juli 2013