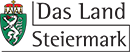Volle Tube ins Unbekannte
Viktor Wiktorowski hat also begonnen, die schneeweiße Arktis von Blatt und Leinwand zu besiedeln.

Ohne viel Federlesens, ohne sich zu sehr um die Schlittenhunde der Kunstgeschichte zu bemühen, einzig versorgt mit Feuer, Kohle, Öl und Farbpigmenten, verwendet wie Getreidesamen, die es zu säen gilt: So ist Viktor Wiktorowskis Arbeitsprozess Urbarmachung ebenso wie gewaltsames Einnisten ins Unwirtliche, ins Format, oft darüber hinaus, farbig auch über sich selbst hinweg. Kurzum: Leinwand, Raum und der Mensch, er selbst, tragen die Spuren und legen Zeugnis seiner Arbeit ab.
Eher also ein zähes Ringen mit dem Eisbären haben wir hier vor uns, weniger einen schonenden Einsatz von Ressourcen, tatsächlich mit viel Gottvertrauen auf den „lucky punch" in Szene gesetzt. Noch hat Viktor, außer seiner Unschuld, wenig zu verlieren. Noch vertraut er mehr dem Gaspedal als der Bremse, noch setzt er wenig die Kupplung ein.
Man sieht große Leinwände, farbig parzelliert, oft verspachtelt, manchmal bestäubt: wilde Gärten! Neuerdings Köpfe, energisch konturiert, abgegrenzt auf horizontalen Strukturen, dazwischen kollaterale informelle Spurenelemente. Da, ein grünes Gesicht, angerührt in einer Bratpfanne, vor einem weiß ins Schwarz getröpfelten Universum ...
Viktor, der autonome Polarforscher, 24 Jahre jung, überdeckt noch mit viel expressiver Selbstverleugnung seinen sensibleren Untergrund, dessen Indizien als Strichhiebe unter Farbe und Nestbündeln aus Kohle durchschimmern, die nämlich kooperieren trotz prozesshafter Automation in szenischen Verbindungen, gehen vom strukturellen Nebeneinander über ins gestalthaft sortierte.
Ein schwieriger Weg ist das, das eigene spontane Aufflackern im Konkreten zum exemplifizierten Stillstand zu bringen, und doch auch gleichnishaft ist dieser Prozess, die vororganischen Tatsachen im anhaltenden ersten Schwung zu einer Verdichtung an die Grenzen ihrer eigenen Naturgesetze zu führen.
Paul Klee hat die Ordnung der Bewegung poetisch ausgefaltet, Jackson Pollock ist in den unendlichen Weiten seines Universums verschollen ... Viktor gibt mir die Hand, natürlich stempelt sie mich mit Ölfarbe. Noch ist eben nicht alles ins Bild verwandelt, aber „Eisstation Zebra" ist voll im Betrieb, und bald wird wohl auch das eigene Funkalphabet vervollständigt sein. Dann erhalten wir Nachricht aus erster Hand. Anno 2013.
Zweiter Besuch in der Grauzone
Nun, ein Jahr später, besuche ich Viktor Wiktorowski neuerlich in Ligist, neugierig wie sich seine Arbeit in dieser Zeit entwickelt hat. Noch tönt es mir sinngemäß im Ohr: „Pardon, aber bei aller Bescheidenheit möchte ich darauf hinweisen, dass ich in vier Jahren soweit bin, dass meine Bilder Höchstpreise erzielen werden."
Nun ist Viktor 25 und liebt, lebt und arbeitet seit drei Jahren in Ligist, im ehemaligen Postgebäude, dem Atelier- und Ausstellungsgebäude der „Villa Weiss" in einer emotionsgeladenen Partnerschaft mit Antoinette Oberländer, der „spiritus rectorin" der Villa, Kunstsammlerin, Magistra der Kunstgeschichte.
„Gibt es einen Satz, den ich unbedingt in den Bericht schreiben soll?"
Viktor: „Nur durch sie bin ich geworden, nur durch sie kann ich sprechen."
Übrigens hat jeder Künstler, der dort jemals ausgestellt hat, von Antoinette einen solchen Satz bekommen und eine Tarotkarte. Aber ich bin ja nicht zum Kartenspielen gekommen, sondern Viktor hat mich eingeladen, dass wir versuchsweise gemeinsam malen, und wohl auch, um einiges im Gespräch zu klären.
Frage: „Zeigst du in deinen Bildern mehr, als du verbirgst?"
Viktor: „Ich verberge mehr, ich möchte ungreifbar bleiben, im Dualen."
Frage: „Dual oder eher dialektisch im Sinne von Ene-Meese-Muh?"
Viktor: „Schon in der Synthese."
Wo man hier auch hingreift, zu Büchern oder Zeitschriften, überall pickt Farbe, aus dem Buch mit den hundert Meisterwerken sind krude mit dem Stanleymesser Fotos herausgeschnitten. Jasper Johns Amerikaflagge zum Beispiel, und bloß ein einziger, fingernagelgroßer Stern findet sich aufgeklebt auf einem von Viktors Bildern wieder. Was für eine Verschwendung. „Ich spür und riech die Farbe gerne ...". Ein Foto von der goldenen Bulldogge von Fabergé dient ihm gerade als Modell für ein Bild, bei ihm natürlich vorherrschend in Schwarzweiß.
„Was bedeuten die zwei Spachtelstriche, Gelb und Rot?"
„Damit wird die Serie markiert."
Viktor zeigt mir seine „Madonna von Ligist", eine dreidimensionale Assemblage, die auch einen Untertitel trägt: „oder Der Papagei des 22. Jahrhunderts".
Vera ikon, das wahre Bild
Der Geschichte der Kunst entflieht man nicht, ob wissend oder unwissentlich, ein Kontext ist immer da. Durch die Entwicklung der Fotografie im 19. Jahrhundert wurde für die Maler die Machart wichtiger (Farbe, Strich, Geste ...); und heute, seit die Fotografie ihrer Pixelhaftigkeit nicht entfliehen kann, wurde die Malerei als Reaktion diffuser. Diffusion ist auch ein wichtiger Aspekt bei den Bildern von Viktor Wiktorowski. Trotzdem ist bei ihm die Bildfindung viel vorsichtiger, als es der krude Malprozess selbst nahelegt.
„Bist du religiös?"
„Ich glaub schon."
Schauen wir uns also den „Gosenden Dornbusch" genauer an.
„Ich glaube an das Böse", sagt Viktor trotzig.
Das wiederum glaube ich ihm nicht, denn das Böse ist buchhalterisch nachtragend, während sich das Gute einfach vergessen lässt. Auch wenn Thomas von Aquin sagt, das Böse käme durch die übertriebene Eile in die Welt, weil dadurch der Mensch sich der plötzlichen Situation gegenübersehe und nicht mehr als souveräner Mensch handeln könne. Mehr scheint's, als kokettiere Viktor mit der Einstellung von Albert Camus‘ Caligula, dessen Willkür die Vertreter des Gemeinwesens provozieren will, ihm in den Arm zu fallen, hier eben in der Hoffnung auf das „Erschauern" vor etwas Wahrhaftigem, das sich innerhalb der Willkür bildet, der Herausbildung eines „vera ikon" am Schweißtuch, dessen Entstehung Geheimnis bleibt. Denn es sind ja vor allem Gesichter, die auf Viktors Bildern hervortreten.
Natürlich tut es mir weh, wie Viktor seine Farben und Pinsel verkommen lässt, seine Bücher versaut und zerfleddert, und natürlich hoffe ich, dass sein Temperament in strukturiertere Rituale mündet, denn ein halbes Kilo Weiß auf der Leinwand spielt schon mehr in der Plastik mit als in der Malerei. Auch würde das genaue Gegenteil - eben Langsamkeit bei der Arbeit, sparsamerer Farbverbrauch - ebenso viele diffuse Gestaltchancen anbieten, ja sich in ein bewussteres Gestaltangebot verwandeln.
Aber der Zeitgeist und seine Teilhaber wollen eben mehr romantischen Spirit und Malgefecht, damit sich keine „staatstragende" Kontrolle zwischen Temperament und Leinwand schieben kann. Jedenfalls: Viktor Wiktorowski stellt am 28. Oktober 2014 in Ligist in der Villa Weiss aus, und da wird man sehen, wie er seine Vehemenz in exemplarische Präsenz verwandelt.
Erwin Michenthaler
August 2014