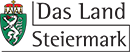Licht, Raum, Klang
Der Künstler Robert Mathy beschäftigt sich in vielen seiner Arbeiten mit der ästhetischen Erfahrbarkeit der unmittelbaren Umgebung.
In der Arbeit „Volume" klopfte er 2011 den Ausstellungsraum auf seine Klangqualitäten ab (Video unter:  http://vimeo.com/52082602 ). Als steirischer Artist in Residence in Sarajevo 2014 tastete er nachts Minenfelder mit einem selbstgebauten Laser ab und hielt das Ergebnis fotografisch fest. Und bei der Gala zur Verleihung der Landeskulturpreise im November 2014 in Graz forderte er die Trägheit des Auges mit bewegten Lichtprojektionen heraus, zu denen raumgreifendes Knistern zu hören war. Der 1979 in Wagna geborene Künstler Robert Mathy besuchte die Ortweinschule in Graz und absolvierte die Klasse für digitale Kunst bei Peter Weibel, Tom Fürstner und Ruth Schnell an der Akademie der angewandten Künste in Wien. In seinen Arbeiten setzt er sich immer wieder kritisch mit der ästhetischen Erfahrbarkeit der unmittelbaren Umgebung auseinander. Sahra Fötschl hat den Künstler interviewt.
http://vimeo.com/52082602 ). Als steirischer Artist in Residence in Sarajevo 2014 tastete er nachts Minenfelder mit einem selbstgebauten Laser ab und hielt das Ergebnis fotografisch fest. Und bei der Gala zur Verleihung der Landeskulturpreise im November 2014 in Graz forderte er die Trägheit des Auges mit bewegten Lichtprojektionen heraus, zu denen raumgreifendes Knistern zu hören war. Der 1979 in Wagna geborene Künstler Robert Mathy besuchte die Ortweinschule in Graz und absolvierte die Klasse für digitale Kunst bei Peter Weibel, Tom Fürstner und Ruth Schnell an der Akademie der angewandten Künste in Wien. In seinen Arbeiten setzt er sich immer wieder kritisch mit der ästhetischen Erfahrbarkeit der unmittelbaren Umgebung auseinander. Sahra Fötschl hat den Künstler interviewt.
Du hast die Ortweinschule in Graz besucht. War es eine gute Zeit für dich?
Ich bin schon sehr froh, auf der Ortweinschule gewesen zu sein. Das war eine interessante Zeit und hat mir auf jeden Fall mehr gebracht, als auf ein Gymnasium oder Ähnliches zu gehen. Die Verbindung von Theorie und Praxis hat mir sehr gut gefallen. Ich würde meine Kinder da auch hinschicken.
Was machst du hauptsächlich im Moment? Filmproduktion, Ausstellungen, Langzeitstudien?
Künstlerisch arbeite ich gerade an zwei konkreten Projekten: zum Einen an der Gestaltung der Gala zur Verleihung der steirischen Landeskulturpreise im Grazer Dom im Berg und zum Anderen an einer neuen Klangperformance, die ich im November 2014 bei den Klangkunsttagen in Wien live darbieten werde. Im Quartier21 (Museumsquartier Wien) lief im Oktober eine Klanginstallation von mir. Sonst mache ich unterschiedliche Jobs zum Geldverdienen. Mit Film habe ich im Moment nicht viel zu tun, habe mir aber vorgenommen das demnächst wieder zu forcieren. Es tut sich vielleicht auch gerade eine Möglichkeit auf, im Theater als Bühnentechniker zu arbeiten. Das ist aber noch nicht spruchreif. Im Grunde bin ich gerade auf der Suche nach Möglichkeiten, um mir meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können und gleichzeitig nicht auf die Kunst verzichten zu müssen.
Wie bist du von digitaler Kunst auf Audio gekommen?
Audio ist ja meist ein Teil in vielen Bereichen der digitalen Kunst. Aber das spezielle Interesse am Klang ist durch zwei Dozenten auf der Universität entstanden: Nicolaj Kirisits und Klaus Filip. Die Vorlesungen und Workshops der beiden waren für mich die produktivsten in der ganzen Uni-Zeit.
Sound und noise sind nicht gleich Musik. - Welche Musikinstrumente spielst du?
Ich habe als Jugendlicher zwei Jahre lang Klavier gelernt. Leider hab ich damit nie weitergemacht. Ich habe also keine klassische Musikausbildung, was ich oft bereue. Heute interessiere ich mich mehr für Klänge an sich. Mit Klängen, Geräuschen kann ich freier umgehen und muss mich nicht den Regeln einer Notation unterordnen. Da tun sich für mich viel mehr Möglichkeiten auf.
Was macht man mit Soundgeräten, wie du sie entwirfst und baust, die Geräusche modulieren und über Computer Bewegung in Sound umwälzen?
Entweder man spielt sie oder sie verstauben irgendwo. (Grinst) - Bei der Arbeit „shape", auf die du vermutlich anspielst, ging es mir um die Bewegung im Raum, die ja beim Spielen jedes klassischen Instruments charakteristisch ist - sei es beim Streifen des Bogens über die Saiten der Violine oder das Schlagen einer Trommel. Ich wollte den Zusammenhang von Klangerzeugung und Bewegung im Raum thematisieren. Beim Arbeiten mit dem Computer als Instrument wird die Körperbewegung meist auf ein Minimum reduziert. Ich glaube ich wollte da wieder mehr Bewegung reinbringen.
Ist das das Kinderspielzeug des nächsten Jahrzehnts oder gibt es Sammler für diese Stücke?
Die Sammler sind mir leider noch nicht untergekommen, aber es gibt zum Beispiel die Guthman Musical Instrument Competition auf der Georgia Tech in Atlanta, wo ich einmal mitgemacht habe, da bin ich sogar ins Finale gekommen: Da werden neu entwickelte Instrumente vorgestellt. Diese Instrumente entstehen meist aus einem Anliegen der Entwickler heraus, bestimmte Klänge auf eine bestimmte Art zu erzeugen, darum bleiben die Instrumente meistens Einzelstücke. Als Kinderspielzeug sehe ich das nicht, aber ich würde es toll finden, wenn man Kindern diesen Zugang zu Klängen ermöglicht. Das wäre vielleicht eine Idee: ein Workshop für Kinder, wo man Instrumente baut.
Hast du noch Kontakt zu Professoren von der Angewandten?
Sporadischer Kontakt besteht. Es gibt einige Dozenten, die ich manchmal zu einem Feedbackgespräch kontaktiere. Zusammenarbeit in dem Sinne besteht nicht, aber es haben sich schon einige Ausstellungs- und Auftrittsmöglichkeiten ergeben, die mir über Lehrbeauftragte der Universität vermittelt wurden.
Wie ist dein Bezug zu Brasilien?
Eigentlich wollte ich ein Auslandssemester in Lissabon machen. Es hat sich aber ergeben, dass ich zu einem Festival nach São Paulo eingeladen wurde. Ein alter Bekannter aus Graz, der schon seit Längerem in São Paulo lebt, war ein zusätzlicher Anknüpfungspunkt. Für mich war danach sehr schnell klar, dass ich dort längere Zeit verbringen möchte. Da es keine Verbindung zwischen den Universitäten in Wien und São Paulo gab, habe ich mir den Kontakt selbst herstellen müssen, und das hat geklappt. Aus einem Semester wurden dann gleich zwei. Und weil mir Brasilien so gut gefällt, habe ich - nach meinem Universitätsabschluss in Wien - noch zwei Monate im Rahmen eines Artist-in-Residence-Programms in Belo Horizonte verbracht.
Gibt es Philosophen, Ingenieure oder Industriesoziologen, die dich inspirierten früher? Jetzt?
Ich glaube, ich bin nicht besonders theorieversiert. Natürlich besteht auch immer ein Teil meiner Arbeiten aus dem dahinterstehenden Konzept, aber ich versuche meine Arbeiten stets so anzulegen, dass sie auch ohne Konzept auskommen könnten, dass sie eine gewisse Einfachheit oder Leichtigkeit aufweisen, die bei genauerer Auseinandersetzung aber auch in die Tiefe gehen. Zuletzt ist mir ein Buch über Alvin Lucier untergekommen, das hat mich sehr beeindruckt, weil ich da Parallelen zu meiner Zugangsweise zur künstlerischen Arbeit mit Klang erkennen konnte.
Leben in Wien oder Leben in der Metropole?
Ich mag Wien inzwischen ganz gern. Als ich vor ca. 13 Jahren nach Wien gezogen bin, mochte ich diese Stadt nicht so sehr. Berufliche Möglichkeiten haben mich hierhergebracht. Jetzt ist Wien eine Art Heimat geworden. Ich kenne die Stadt und viele Menschen, die in ihr leben, das verbindet natürlich. Auch das kulturelle Angebot kann sich sehen lassen.
Auf Österreich bezogen ist Wien auf jeden Fall eine Metropole. Auf ganz Europa bezogen schon weniger. Als ich das erste Mal nach São Paulo kam, wurde meine Vorstellung, die ich von einer Großstadt hatte, das erste Mal bestätigt. Das war ein überwältigendes Erlebnis für mich.
Sahra Fötschl
Stand: Oktober 2014