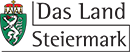Nicht der Atelier-Typ
Michael Goldgruber lernte bei einem Werbefotografen, nahm einen Umweg über die Malerei und fotografiert heute scheinbare Skulpturen im Meer oder Aussichtsterrassen im Gebirge. Sein Thema: Die Sehnsucht nach der Natur.
Mit der Malerei hat Michael Goldgruber schon vor längerer Zeit aufgehört. Und doch: Betritt man sein Atelier im 3. Wiener Bezirk, so meint man zunächst, im Studio eines Malers zu stehen. Schon am Gang riecht es nach Farbe.
Goldgruber, freundliches Auftreten, steirisches Idiom, teilt sein Studio mit Ulrich Plieschnig, dessen abstrakte Leinwände hier überall herumstehen. Wobei Goldgruber, so sagt er, nicht wirklich der „Atelier-Typ“ ist: „Mit der Malerei habe ich mich eigentlich verrannt. Denn eigentlich habe ich viel mehr das Bedürfnis, draußen zu arbeiten.“
Und das muss der 1965 geborene Künstler auch: Seine Fotografien und Filme drehen sich häufig um die Natur und deren Betrachtung. In seinen großformatigen Arbeiten strecken sich großzügige Aussichtsterrassen in Gebirgszüge, schlängeln sich schmale Treppen Bergkämme hinauf, geben große Fensterflächen den Blick frei auf eine schneebedeckte, klare Landschaft: Produkte einer „Freizeitindustrie, welche einerseits mit der Unberührtheit der Natur wirbt, andererseits das Einssein mit dieser durch eigens Gebautes reglementiert und damit einhergehend auch den zu betrachtenden Ausschnitt von Landschaft vorgibt“, wie die Kunstkritikerin Manisha Jothady in seinem Katalog schrieb. Es sind die Sehnsuchtsorte, die Goldgruber gern aufsucht und fotografiert, solche, „die mit dem Unbekannten zu tun haben, mit der Weite und der Ferne – die man aber gleichzeitig versucht zu zähmen“, wie er sagt. Die oft gar nicht so unveränderlich sind: „Es herrscht die allgemeine Vorstellung, dass ein Gebirge eine unveränderliche Entität ist. Das stimmt aber nicht. Ein Berg trägt ein Verfallsmoment in sich. Das sieht man etwa am Hochschwab gut.“ Immer wieder zieht es den gebürtigen Leobener in die Steiermark zurück.
Weiter hinten im Atelier zieht er dann einige Fotoarbeiten hervor, auf denen er ein ebenso romantisch besetztes Landschafssujet wie die Berge abgebildet hat: das Meer. Genauer gesagt einen jener Küstenstreifen in der Normandie, an denen 1944 die Amerikaner landeten, Utah Beach. Wie „skulpturale Elemente“ (Goldgruber) ragen Betonrampen aus dem Wasser, verändern sich stetig mit den Gezeiten. Nicht nur in Fotografien, auch in langsamen, stillen, gänzlich unspektakulären Filme übersetzt Goldgruber seine künstlerischen Reflexionen. Man sieht den Arbeiten ihre sorgsame Komposition, ihre bedachte Gestaltung an. Das gilt auch für jenen dunklen Tableaux, auf denen Einblicke in Monokulturen zu sehen sind: Man merkt, dass es sich hier um keine Schnappschüsse handelt. Die quantitativen Möglichkeiten und scheinbar unbegrenzten Speicherkapazitäten des digitalen Zeitalters scheinen Goldgruber denkbar wenig zu beeindrucken. „Das Hamstern von Bildern habe ich hinter mir. Das werden bloß chaotische Ansammlungen, von denen man nichts hat“, erklärt er.
Was die überlegte Bilderkomposition betrifft, so kann er auf reiche Erfahrungen verweisen, lernte er doch früh bei einem Werbefotografen, der sich vor allem mit der Abbildung von Autos befasste. „Autos sind sehr schwierig zu fotografieren“, erinnert sich der Künstler, „immer spiegelt es irgendwo. Es darf nicht zu viele Reflexionen geben – aber auch nicht zu wenig.“
Im Moment hat sich Goldgruber neuem Terrain zugewandt. Für eine Ausstellung im Österreichischen Kulturforum in Paris anlässlich der Fussball-EM hat er jugendliche Flüchtlinge, die in einer Wiener Unterkunft wohnen, beim Fußballspielen beobachtet. In einer Videoinstallation kombiniert er Aufnahmen der Teenager, die eine Minute lang abwesend in die Ferne blicken mit solchen von der Spielaction im Ballkäfig, die auch der Bewältigung von Emotionen dient. Sehnsucht und Realität: Hier kommen sie zusammen.
Homepage von Michael Goldgruber:  http://www.goldgruber.at/
http://www.goldgruber.at/
Nina Schedlmayer
Stand: März 2016