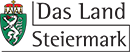Zuerst kommt der Sound, dann kommt das Bild (*)
Der Künstler Peter Kutin bespielt das Feld von zeitgenössischer elektronischer Musik, definiert einen klaren konzeptuellen Rahmen und setzt Bilder als Korrespondenten ein.
Direkt zum *Update 2019
Der in Leoben geborene und in Knittelfeld im Murtal aufgewachsene Künstler hat klare künstlerische Vorstellungen, was seinen komponierten Sound, seinen kreierten Ton und dessen klangliche Wirkung anbelangt. Im Gespräch mit ihm über seine Kunst und seine Projekte tauchen wir in interessante Tiefen einer zeitgenössischen elektronisch-akustischen Klangwelt ein. Jedes Jahr entwickelt, organisiert, komponiert, gestaltet und verwirklicht Kutin ein „größeres Projekt, das meine Handschrift trägt.“ Kompositionsaufträge oder Festivalbeiträge: Kutin steuert dabei nicht nur das Soundpult, sondern er gibt seinen Klangvorstellungen einen visuellen Kontext. Somit rezeptiert das Publikum ein filmisches Gesamtkunstwerk, wobei der Ton im Vordergrund steht.
Viele Dinge, Methoden, Werkzeuge und viel Wissen hat sich Kutin durch sein neugieriges Interesse an der Welt des Klanges, die uns täglich und immer umgibt, selbst angeeignet. Verfeinert und theoretisch gefestigt hat er sein Wissen durch den ELAK - Lehrgang für Computermusik und elektronische Medien an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Seine Arbeiten „stützen sich jeweils auf die konzeptuell komponierte Tonebene und hinterfragen in ihrer Aufführungspraxis die Spartentrennung der Künste an sich.“ In jedem seiner Projekte steckt mitunter der Grundsatz: „Die Vielfalt begrenzen, das Feld genau abstecken.“
Das stringent Narrative interessiert ihn nicht, somit bleibt er in seinen Werken Erklärungen schuldig oder lässt sie offen und gibt dem Publikum einen ungeahnten Raum zur Konfrontation mit Bild und Ton. Sein gemeinsam mit dem Salzburger Komponisten Florian Kindlinger erarbeiteter Film „Desert Bloom (2016)“ macht prinzipiell Nicht-Wahrgenommenes hörbar. Diese Grenzüberschreitung funktioniert, weil der Künstler elektromagnetische Wellen durch Induktion in Klang verwandelt. Inhaltliche Grundlage ist das flimmernde, blinkende und pulsierende Lichtermeer von Las Vegas, diese leuchtende Welt aus Neonleuchttafeln, LED-Bildschirmen und Lichtemissionen, die eine ganze Stadt weit in den Himmel in einem gestreuten Lichtspektrum hell erstrahlen lässt. „Die Welt klingt verrückt“, stellt Kutin fest, der vor Ort die Klangwelt der Lichtquellen aufnahm, Elektrosmog in Ton festhielt und somit einen Sound für den Film kreierte, der die fließenden (Strom-)Bilder mit Punkten und Linien, unweigerlich verstärkt. Klang und Bild werden zu einer Symbiose, in der beide auf ein und derselben Ebene verschränkt korrespondieren.
Eine charakteristische Arbeit ist auch sein jüngster Film „The Fifth Wall (2017)“: Eine Panzerglasscheibe mit einer Größe von drei mal zwei Meter und einem Gesamtgewicht von 400 Kilogramm wurde in einer Halle in Halterungen eingespannt und langsam mit unterschiedlichsten Gegenständen zerstört. Die Scheibe war mit jenen Sensoren versehen, die normalerweise für Crash-Tests verwendet werden, um die Zerstörung auditiv wahrnehmbar zu machen.
Und filmisch wurde diese Glasscheibe scheinbar zwischen Publikum und Kamera platziert. Diese spezielle Kameraperspektive vermittelte dem Zuseher den Eindruck, dass die Kinoleinwand vor ihm kaputtgehen würde. Kutins Drehbuch spricht man von einer Displaymetapher: „Das Innere kommt nach außen.“ Bei seinem Aufenthalt in Sarajevo im Rahmen des Film-Auslandsstipendiums des Landes Steiermark 2015 kam ihm die Idee zu diesem Werk. Gedankliche Grundlage für seine künstlerische Auseinandersetzung war die massive Flüchtlingsbewegung aus Syrien und den umliegenden Staaten über die damals offene Balkanroute. Kutin verfolgte diese Massenbewegung und die Öffnung der Grenzen über die digitalen Medien und stellte die Frage, ob Empathie und ein „Dabei sein“ überhaupt möglich sei. „Durch die Trennung über einen Bildschirm oder ein Display gibt es körperlich kein Empfinden. Der Empathie im digitalen Raum folgt eine Überforderung, was man denken soll." Dieser Film, zu dem es eine Reihe von Soundfiles mit der Zerstörung der Panzerglasscheibe gibt, feierte Anfang Juni 2017 beim VIS - Vienna Shorts Festival in Wien Premiere.
Kutin arbeitet auch für andere Filmemacher: Seine jüngste Tongestaltung galt dem Science-Fiction-Film/Dokumentarfilm „Homo Sapiens“ des ausgezeichneten österreichischen Regisseurs Nikolaus Geyrhalter, für die er auch auf der DIAGONALE - Festival des österreichischen Films 2017 mit dem Preis für das beste Sound-Design ausgezeichnet wurde. Sein Resümee zu dieser Arbeit: „Hier lernt man Zurückhaltung, Konsequenz und Subtilität. In so einem Fall gibt das Bild den Impuls für den passenden Klang."
Vielen FilmemacherInnen fehlt es an Erfahrung und Auseinandersetzung mit Ton, Musik und Klang für ihren Film. Für Kutin ist es ein Betätigungsfeld, das er (auch finanziell) zum Überleben braucht: „Die Soundebene ist extrem wichtig, daher setze ich ganz strenge Tonkonzepte um.“ Generell manipuliert Musik das Bild und gibt dem Film eine emotionale Dichte. Für den Filmemacher verschmilzt Ton und Bild, der Ton wird zur Psychoakustik.In seiner Vielfältigkeit gibt Kutin im Bereich Experimentalmusik auch Live-Konzerte und tritt als Komponist zeitgenössischer elektronischer Musik auf. Für 2018 ist für die Darmstädter Ferienkurse ein größeres Stück geplant und in Arbeit.
Kutin ist 2017/18 Stipendiat des KUNSTRAUM STEIERMARK-Programms und teilt sich mit Lisbeth Kovacic und Karl Wratschko ein Atelier in St. Andrä im Sausal. „Wir leben alle in Wien und wollen abseits der Großstadt in Ruhe und Abgeschiedenheit, im Bundesland, in dem wir geboren sind, an unseren Projekten arbeiten können.“ Im September 2017 werden die drei die 1. Sausaler Biennale veranstalten, ein grenzüberschreitendes Projekt, das im Rahmen des CALL 2017 - „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt - ist das so?“ umgesetzt wird. Website Peter Kutin >>
Website Peter Kutin >>
Petra Sieder-Grabner
Stand: Juni 2017
*Update 2019: Mit realen Gegebenheiten arbeiten
(Ein Interview per E-Mail anlässlich Peter Kutins Aufenthalt in Tirana, Albanien, im Rahmen eines Film-Auslandsstipendiums des Landes Steiermark)
Was erwartest du dir von diesem Aufenthalt in Tirana?
Durch andere und neue Eindrücke angeregt zu werden - das passiert ja immer auf Reisen und Auslandsaufenthalten. Ich bin selber schon gespannt darauf.
Was ist dein künstlerisches Vorhaben in Tirana?
Es gibt natürlich Dinge, an die man vorab denkt, wo man ansetzen könnte oder möchte. Aber nach den ersten zwei Wochen war klar, dass man alles im Vorhinein Projizierte sofort über Bord werfen und vor Ort mit den realen Gegebenheiten arbeiten muss, um auch nicht aus seiner unweigerlich falschen Vorstellung zu schöpfen. Nur Erfahrungswerte zählen.
Wie ist dein erster Eindruck, dein erstes Gefühl, von dieser multikulturellen, im Aufbruch befindlichen Stadt?
Es gibt sehr viel Altes und parallel dazu sehr viel Modernes. Das reibt sich irgendwo ganz gut aneinander. Albanien wird seit geraumer Zeit auch als Narco*-Staat bezeichnet und ist somit der erste Europas. Das schlägt sich auch nieder. Investoren gibt es hier jede Menge, das führt u. a. zu sehr poshen** Fassaden, aber auch zu einem China-Lokal, das authentische Szechuan-Küche anbietet. Versuch einmal, so ein Lokal in Graz zu finden. Um eine profundere Auskunft zu geben, fühle ich mich noch nicht imstande.
Was ist dein zweiter Eindruck?
Das Wetter ist sehr gut. Die Luft eher schlecht. Das Rauchen ist sehr billig. Die Parkwächter ähneln einander. Einer von ihnen rauchte zwei Zigaretten parallel, also zog an beiden gleichzeitig - das hinterlässt schon irgendwo einen Eindruck.
Welchen Einfluss haben diese Eindrücke auf dein künstlerisches Vorhaben?
Die müssen erst sickern, um genauer beschrieben werden zu können. Aber es wird um ein altes Theater gehen, das bald abgerissen werden soll und das momentan besetzt ist - als einziges Haus in Albanien. Es ist ein schönes
altes Theater, ohne Strom, respektive ein sehr finsterer Raum. Aber - und jetzt wird's kitschig - es gibt ja überall Risse, wo das Licht durchkommt ...
Hat sich dieses Vorhaben im Laufe deines Aufenthalts verändert?
Total. Jeden Tag verändert es sich weiter. Dieser Prozess ließe sich als künstlerische Entwicklung beschreiben.
Was berührt dich an Tirana besonders?
Dass die Polizei die „Touristen" offensichtlich gezwungenermaßen sehr lieb haben muss.
Welche Kontakte kannst du dort knüpfen?
Die Organisatorin der Residency - Valentina Koça - ist hier eine wirklich gute Vermittlerin. Die Raiffeisenbank fliegt ja anscheinend wöchentlich renommierte KünstlerInnen aller Sparten aus Österreich nach Tirana ein. Filmfestival ist auch noch. Man kommt beinahe nicht zum Arbeiten.
Wie sehr kannst du in die künstlerische bzw. Film-Szene von Tirana/Albanien eintauchen? Gibt es Besonderheiten?
Film eher wenig, aber Kunst im Allgemeinen sehr gut. Bildende Kunst scheint hier sehr im Kommen zu sein und bekommt auch Aufmerksamkeit. Mir scheinen sehr viele künstlerische Arbeiten sehr fokussiert auf explizite politische Probleme des Landes selbst zu sein. Nach außen gelangt dieser Blick recht wenig.
Was wirst du von deinem Aufenthalt mit nach Hause nehmen?
Nüsse. Jede Menge Nüsse. Vor allem die Walnuss ist hier äußerst schmackhaft und preiswert.
Inwiefern werden die Eindrücke, die du dort gewinnst, in deine nächsten künstlerischen Projekte einfließen?
Da habe ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung.
Ein abschließender Satz zu Film und Tirana?
Gestern war ich in einem Screening des internationalen Filmfestivals in Tirana. Die Vorstellung war um 19:00 Uhr, also Primetime. Neben mir saßen noch zwei Leute im Saal. Einer fing nach sechzig Minuten an zu schnarchen. Der Zweite hat einmal kurz zwischendurch laut telefoniert. Der Film war jetzt aber auch nicht wirklich gut, das muss man sagen. Ich denke, beide hatten irgendwie auch recht.
Aus der Publikation zu den Landes-Kunst- und -Kulturpreisen 2019
Herbst 2019