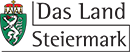Wo liegen die Grenzen....
Sie hat drei handwerkliche Ausbildungen, dabei suchte sie immer ihren eigenen Weg in die Kunst: Die Keramikerin und Ortwein-Meisterschule-Absolventin Beate Gatschelhofer ist eine sorgfältige, überlegte, anspruchsvolle und engagierte junge Künstlerin.
Sie war 14 Jahre alt, hatte die Hauptschule hinter sich und war sich völlig sicher, dass sie eine Ausbildung brauchte, in der die Arbeit mit ihren Händen eine wesentliche Rolle spielte. Ihr Talent und ihr Hang zum Künstlerischen kristallisierten sich im Verlauf ihrer Ausbildungen mit einer beeindruckenden Kontinuität heraus. So entschied sie sich für die Landesfachschule für Keramik und Ofenbau in Stoob im Mittelburgenland. Es sei eine sehr traditionelle handwerkliche Ausbildung gewesen, erinnert sich die 23-Jährige, die sich zu Beginn vor allem für den Kachelofenbau interessierte. Während dieser Ausbildung reifte in ihr der Wunsch, sich künstlerisch mit Material und „Welt" auseinanderzusetzen, etwas auszuprobieren, Gedanken und Ideen in Keramik zu gießen. Sie wollte (und will noch immer) Grenzen von Materialien ausloten und erkannte, dass Keramik viel mehr kann, als es auf den ersten Blick scheint. Gleichzeitig spürte sie, dass sie aus dieser konservativen Art der Ausbildung ausbrechen musste, um mit ihren handwerklichen Fähigkeiten einen anderen Weg zu gehen. Das war mit ein Grund, warum sie nach dem Abschluss der Fachschule einen persönlichen Abstand zur Keramik suchte und sich dem Material Glas zuwandte. Daher absolvierte sie noch den Aufbaulehrgang für Kunsthandwerk und Objektdesign an der Glasfachschule HTL Kramsach in Tirol. Die dort erlernten Glastechnologien schwingen nun in ihren aktuellen keramischen Formen mit.
Der Neubeginn in Tirol hatte sie positiv gestimmt, zumal ihr die Schule für ihre Ideen künstlerischen Freiraum gelassen. Mit ihrer Abschlussarbeit konnte sie erstmals eine künstlerische Arbeit abgeben, in der Gatschelhofer auch den ihr so wichtigen gesellschaftlichen Mehrwert zum Ausdruck bringen konnte.
Sie gestaltete ihre Arbeit zum vorgegebenen Thema „Vergänglichkeit" und widmete sich intensiv den Themen „Verlust und Konservierung". In selbst geblasenen, fragilen Glasröhrchen steckte die Künstlerin selbst geschriebene Briefe, ihre täglichen, spontanen Gedanken zum Thema Vergänglichkeit, und verschloss die Röhrchen dicht. Die Briefe schrieb sie mit ihrem eigenen Blut, das sie sich von einer Ärztin dafür abnehmen hatte lassen. „Blut deshalb, um eben nicht nur geschriebene Worte, sondern auch genetische Information mit zu konservieren, um so die niedergeschriebenen Gedanken unmittelbar auf den Verfasser zurückführen zu können." Die geschlossen und befüllten Glasröhrchen erhitzte sie über einer Flamme, wobei die Briefe durch die Hitzeentwicklung verbrannten und eine bernsteinfarbene Flüssigkeit in den Glasröhrchen kondensierte. Schließlich schuf sie durch ein Raumkonzept mit Licht und Stoffelementen eine begehbare Rauminstallation, in der die Glasröhrchen paarweise von der Decke herabhingen.
Nach ihrer Ausbildung in Tirol kehrte sie wieder in die Steiermark zurück:
Ob Glas oder Keramik der Schwerpunkt ihrer weiteren Arbeiten sein sollte, darüber wollte sie an der Meisterschule für Kunst und Gestaltung, Keramische Formgebung, an der HTBLVA Ortweinschule Graz Klarheit bekommen.
Es war das Porzellan, dem sie sich nun zuwandte und das sie seitdem in all seinen Eigenschaften, Eigenheiten und Besonderheiten erforscht.
In einer Ausstellung im Schloss St. Martin (Graz/Straßgang) setzte sie sich zum Thema „Bewegung" mit der Flüchtlingsbewegung und ihrer medialen Resonanz auseinander und bediente sich in ihrem künstlerischen Werk der Metapher bewegter Naturkatastrophen, Lawinen oder Wellen, die herein- und herabstürzen und bedrohlich sein können.
Sie gestaltete einen höchst fragil wirkenden Wellenteppich aus Porzellan, der über einen Holzschemel fließt und dessen Oberfläche aus unzähligen kleinen einzeln und individuell geformten wellenartigen Blättern besteht. Diese Kombination aus Holz und Porzellan verbildlicht für Gatschelhofer eine Hürde, die gesellschaftliche Akzeptanz erschwert.
Die Kombination der Materialien Keramik und Holz zeigt sich auch in ihrer Abschlussarbeit für die Meisterschule. „Ich mag den Kontrast Holz und Porzellan, und Holz ist für mich ein schönes Material." Nun diente ein alter Holzkasten als Metapher: „Die Idee entwickelte sich bei einem Blick in meinen Kleiderkasten, in dem sich einige Kleidungsstücke befinden, die keinen Platz mehr in meinem Leben haben, aber trotzdem ein Teil meiner Vergangenheit sind. Kleidungsstücke wie Kleider und Röcke, die nun zur Nichtigkeit geworden sind, da der gesellschaftliche Zwang der Gruppenzugehörigkeit irgendwann dem Wunsch der Selbstdefinierung gewichen war. Ausgehend von dieser Tatsache war es mir ein Anliegen, diese Kleidung in keramischer Form in einem alten Kleiderkasten zu präsentieren, sozusagen die Reste des gesellschaftlich konstruierten Ichs in einem alten Kleiderkasten zu konservieren. Der Kleiderkasten als Symbolträger der Thematik sowie als Präsentationsfläche spielt in der Arbeit eine zentrale Rolle."
In ihrer Arbeit mit dem Titel „Ohne Titel, ohne Anrede" hat die junge Künstlerin im Rahmen des Ortweinstipendiums 2016 diesen Gedanken des Materialkontrasts weiterentwickelt und ihre fragilen Porzellanformen über Metallregale und Holzschemel im Museum der Geschichte (Universalmuseum Joanneum) in Graz fließen lassen. Das Stipendium bot ihr auch genug Zeit, um ihren Umgang mit Porzellan zu perfektionieren. Porzellan kann in seiner Oberfläche roh, glasiert oder überzogen ausgeformt werden und bedeutet dadurch immer etwas anderes. „In der Arbeit geht es mir nicht um meinen Bezug zu Kleidung, sondern vielmehr um die generelle Sichtweise von Kleidung als Hülle, über die wir uns gestalten. Deswegen habe ich unterschiedliche Oberflächen des Porzellans gestaltet", erklärt Gatschelhofer. Viele zerbrochene Porzellanformen erzählen von einem harten Weg und dem hohen Aufwand und technischen Anspruch der Künstlerin.
Die Themen, mit denen sie sich künstlerisch auseinandersetzt, findet sie im gesellschaftlichen Alltag in Normen und Vorschriften, über die ihrer Meinung nach wenig bis gar nicht nachgedacht wird und die sie in ihren Arbeiten hinterfragt. Gatschelhofer tastet sich in ihrem künstlerischen Leben mit Bedacht und Konzentration weiter, setzt nebenbei verschiedene kleine Auftragswerke und Keramikprojekte um und möchte sich durch ihre Kunst entfalten können.
Petra Sieder-Grabner
September 2017