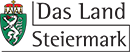Klischees törnen ab
Für ihr Romandebüt „Sechzehn Wörter“ erhielt die in Graz lebende Autorin Nava Ebrahimi den Debütpreis des Österreichischen Buchpreises 2017.
Dass sie offen abgelehnt, zurückgewiesen wurde wegen ihrer Herkunft, ist Nava Ebrahimi, wie sie erzählt, nur ein einziges Mal passiert. Bezeichnenderweise durch einen Professor, der sich wahrscheinlich als liberal verstand und jeden Vorwurf der Ausländerfeindlichkeit von sich gewiesen hätte, der aber meinte, dass die zierliche Studentin mit den dunklen Augen, den pechschwarzen Haaren und dem komischen Namen das komplexe historische Thema, das sie da vorschlug, wohl unmöglich würde bearbeiten können. „Integration", Fremdheit und Nähe, „Migrationshintergrund": Wie schlecht eignet sich das alles für unsere Neigung, an diesen Themen unsere weltanschauliche Haltung kenntlich zu machen!
Wie Mona, die Heldin in ihrem ersten Roman, ist Nava Ebrahimi, geboren 1978 in Teheran, toll integriert, wie man so sagt. Sie spricht ein elaboriertes, akzentfreies Deutsch und ist mit der Debattenkultur Deutschlands bestens vertraut. Kein Wunder: Sie ist drei Jahre alt, als sie mit den Eltern nach Köln kommt. Mit sechs geht Nava auf eine katholische Grundschule: „Da war ich war die einzige Ausländerin." Selbst mit der Schwester spricht sie rasch Deutsch. Es folgt ein evangelisches Gymnasium im Westerwald. Später dann auf der Kölner Journalistenschule, hat es „vor mir mal einen Halbitaliener gegeben". Schließlich landet sie mitten im Herzen modernen deutschen Fühlens und Denkens, bei der „Financial Times Deutschland" und bei der „StadtRevue", einer Art (monatlichem) „Falter" auf Kölsch. Eine Community aus emigrierten Landsleuten lernt sie nicht kennen. Vermisst sie auch nicht: „Solche Communitys wollen immer zeigen, wie gut sie integriert sind, und verkrachen sich dann darüber." Für Iraner, „die „Franzosen des Orients", mag das in besonderem Maße gelten, meint sie. In Deutschland wie in Österreich sind sie meistens Elite-Migranten, politische Flüchtlinge im engsten Sinne. Navas Vater hat in Deutschland studiert, bevor er vor dem Regime der Mullahs flieht.
Toll integriert? „Meine Identität beschäftigt mich eigentlich irgendwie, solange ich denken kann", sagt Ebrahimi, und es ist alles andere als ihre Obsession. Schon als Kind macht sie irritierende Erfahrungen. Im Roman finden sich schöne Szenen mit Klassenkameradinnen und deren Eltern. Später sind es die deutschen oder, wie es jetzt heißt, „biodeutschen" Freunde. Die „blonden Männer", mit denen die heranwachsende Mona in Köln eine Beziehung eingeht, belegen alle ganz schnell Persischkurse und kochen iranisch. Aber schon bald sind ihnen die ewigen Grilltomaten zu verbrannt. Mehr als zehn Wörter Persisch hat keiner von ihnen gelernt. Dass Mona - und Nava - neben ihrer vollwertigen deutschen auch über eine vollwertige „fremde" Identität verfügen, nehmen sie nicht zur Kenntnis. Eine Hälfte fehlt.
Die zweite Identität, über die alle so „großzügig" hinwegsehen, besteht nicht nur aus den „Sehnsüchten meiner Eltern", sagt Ebrahimi, mit denen sie ja groß geworden sei. Sie kann vielmehr handfeste Folgen haben. Nach dem 11. September 2001 hat auch die 13-jährige Nava erleben müssen, dass sie „umgeframet" wurde: Aus Arabern, Palästinensern, Türken, Afghanen, Iranern wurden in der Öffentlichkeit „Muslime". Islamisierung von außen: „Plötzlich wurde man gefragt, ob man Schweinefleisch isst. Vorher habe ich gedacht, der Islam geht mich nicht wirklich was an." Ob die Klischees freundlich sind oder böse, ist nicht so wichtig. Sie törnen alle gleichermaßen ab. Dann kam Donald Trumps „Muslim ban", hinderte die Doppelstaatsbürgerin Nava an USA-Reisen und verletzte gerade die Perser in Amerika, die sich doch nicht zufällig zum Erzfeind der Ajatollahs geflüchtet hatten, besonders tief. Man lernt: Das Thema Identität gehört ganz schnell entpolitisiert.
Nava Ebrahimi hat dann doch einen „blonden Mann" geheiratet, Matthias, einen Astrophysiker aus Graz, den sie in Berlin kennengelernt hat. Inzwischen ist das zweite Kind gekommen. Der zweite Roman ist in der Mache. „Es geht um den Iran, um drei Männer, ist viel weniger autobiografisch." Wie man an Matthias sieht, sind nicht nur die blonden Männer nicht alle gleich. Auch die Länder sind es nicht. In Deutschland, wo die nationale Identität sich auf Abstammung gründet, findet Ebrahimi es schwieriger als im - ansonsten so stark nach rechts verschobenen - Österreich, wo man sich auf die „Kultur" beruft. „Hier bin ich die Deutsche", sagt sie. Der Akzent macht es; Teint und Haarfarbe tun nichts dazu.
Dass die Abspaltung der zweiten, „fremden" Identität die unausweichliche Folge von Migration sei, wie man oft hören kann, glaubt Ebrahimi nicht. Tatsächlich sei ja der andere nationale Hintergrund „nichts, wofür man sich schämen müsste". Schulen hätten das ja begriffen, wenn sie die Vielsprachigkeit ihrer Schüler als Bereicherung nähmen. Dass über solche Einsichten jetzt wieder gestritten wird, zeigt, wie weit die politische Diskussion vom Lebensalltag von 20 Prozent unserer Mitbürger entfernt ist.
Norbert Mappes-Niediek
Stand: Februar 2018