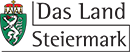Die Dehnbarkeit der Architektur
Räume auf das Unbestimmte reflektieren und sich künstlerisch zwischen den Welten bewegen: Christoph Solstreif-Pirker geht seinen eigenen Weg.

Ein Architekt, der nicht durch das Bauen und Bebauen von Räumen atmosphärische und damit emotionale Zustände erzeugen möchte, sondern der Emotionen, Gedanken und Phantasien hervorruft, indem er Räume performativ vermittelt, ist grenzüberschreitender, künstlerischer Baumeister - oder auch nicht. Die Worte zu finden, mit denen die künstlerische Arbeit von Solstreif-Pirker beschrieben werden kann, ist nicht leicht. Dieser außergewöhnliche Künstler bewegt sich auf ganz neuen genre- und spartenübergreifenden Wegen. Schon früh - mit 15 Jahren - begann er, an der Kunstuniversität Graz Orgel zu studieren. Schnell fokussierte er seine musikalischen Intentionen auf diesen „mechanischen, analogen Synthesizer mit dem größten Tonumfang", auf das Improvisieren und nicht auf das Interpretieren. Und dabei begleiteten ihn Gedanken zum Thema Raum in seinem Ursprung: die Orgel als räumliches Gebilde in ihrer ganzen Größe, der Raum, in dem sie klang, und auch der Klang, den der Raum seinerseits erzeugte. Diese Verbindung von Klang und Raum brachte ihn zur Architektur, auch wenn dem gebürtigen Obersteirer von Anfang an klar war, dass er mit seiner Arbeit die etablierten Grenzen der Architektur ausdehnen musste.
Anfangs beschäftigte ihn das Zeichnen und Malen. Während seines Studienaufenthaltes an der Kunstakademie in Kopenhagen zeichnete er - abstrakte Linienzeichnungen, Diagramme, Karten. Es war das analoge Arbeiten, das ihn faszinierte, ihn aber gleichzeitig zu einem Außenseiter machte: „Ich bin allein dagestanden. Alles, was ich tat, wirkte unglaublich neu, und doch anachronistisch." Seine Diplomarbeit an der TU Graz war eine von wenigen künstlerisch-forschenden Arbeiten mit dem fordernden Titel „Analoge Landschaft: Annäherungen an den Verlorenen Raum des Unbestimmten". Der 30-Jährige möchte in der Architektur eine Formensprache konkretisieren, in der das Objekt nicht konkret und endlich ist, sondern einem „tieferen, unbestimmten Objektbegriff" folgt. In seinem Zugang sind die Begriffe Raum und Zeit eng miteinander verknüpft, man könne eine aus der Malerei kommende Form so lange bearbeiten und transformieren, bis sie zum Raum würde: „Auch Landschaft ist nicht statisch, sondern kann ein Kräftefeld aus sich heraus sein, dynamisch wie ein Gewebe, aus dem Architektur entsteht."
Grundlage für seine Diplomarbeit waren Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg in den Südtiroler Dolomiten, die „dort versteckt in den Berg eingebaut sind". Für Solstreif-Pirkers Auge war klar: „Mit der Felswand stimmt etwas nicht." Wo liegt die Grenze zwischen dem natürlichen und dem künstlichen Berg? Welche räumliche Äußerung kommt heraus, wenn verschiedene Schichten des Berges in einer neuen Architektur gebündelt werden?
In seiner theoretischen Reflexion folgte er dem Begriff des Unbestimmten und nicht der Leere oder Nicht-Relevanz. Wie kann Form und räumlicher Ausdruck mehr sein, als funktionalen Programmatiken zu genügen? Christoph Solstreif-Pirker weiß, dass er mit seinen Gedanken gegen eine gängige Architekturpraxis läuft. Bestätigung für seinen theoretisch-künstlerischen Weg bekam er von einer externen internationalen Jury, die sämtliche Architektur-Diplomarbeiten eines Jahrgangs bewertete und ihn 2016 mit seiner Arbeit zum Sieger kürte.
Seit 2016 liegt der Fokus seiner künstlerischen Praxis zunehmend auf immateriellen Aspekten des Raumes, wie Relationen, Atmosphären oder Stimmungen. Christoph Solstreif-Pirker lehrt und forscht als Universitätsassistent am Institut für Architektur und Landschaft an der TU Graz und untersucht dort die vielfältigen Verschränkungen zwischen Umwelt, Gesellschaft und Subjektivität. Christoph Solstreif-Pirker will in seiner Forschung jedoch noch weitergehen: als Dissertant am Institut für Zeitgenössische Kunst setzt er sich mit ambivalenten Architekturen des Anthropozäns auseinander - dies in einem internationalen Kontext. „Natürlich könnte ich vermessen, Referenzen zusammentragen, Pläne anfertigen - doch das alles kann nicht die Absurdität des gegenwärtigen planetarischen Raumes festhalten", ist der Künstler überzeugt. Er möchte durch eine unmittelbare künstlerisch-forschende Begegnung herausfinden, was in der Beziehung zwischen Mensch und Umwelt ermöglicht wird und wie Architektur im 21. Jahrhundert neu gedacht werden kann.
Und so ist Christoph Solstreif-Pirker bei der Performance gelandet: „Zeichnungen allein reichen nicht aus. Erst in der unmittelbaren performativen Begegnung kann etwas Neues, ein neuer, dehnbarer (Wissens-)Raum, entstehen." Unterstützung bekommt er dabei von seiner Betreuerin Milica Tomić, einer genreübergreifend arbeitenden Künstlerin und Pädagogin, die das Institut für Zeitgenössische Kunst an der TU Graz leitet.
Der Künstler und Architekt ist seit 2019 Stipendiat des KUNSTRAUM STEIERMARK Programms. In seiner Bewerbung schrieb er: „Jetzt ist die richtige Zeit (...) dass sich die Umrisse eines eigenen künstlerischen Diskurses abzuzeichnen beginnen." Sein Atelier ist Arbeits-, Diskussions- und Forschungsraum, ein Ort einer vielfältigen, künstlerischen Forschungspraxis, die gerade erst begonnen hat.
Petra Sieder-Grabner
November 2019