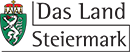Schrei mit dem Ei
In Patrick Topitschnigs Arbeiten tritt die Inszenierung von Orten und Schauplätzen zu Tage. In seinen Installationen und Videos spielt auch der Sound eine zentrale Rolle.

Wirres Haar, weißer Kittel, bisweilen starrer Blick und im Hintergrund eine Tafel mit enigmatischen technischen Aufzeichnungen: Der Mann entspricht ganz dem Typus des verrückten Wissenschaftlers. Sein Spezialgebiet ist der Schrei. Gleich zu Beginn des Films präsentiert er eine Maschine. Diese eigne sich bestens zur Energieerzeugung per Schall: „Man könnte in der Früh aufstehen, das Gerät anschreien und ein Ei zum Kochen bringen", erklärt er im Brustton der Überzeugung.
Patrick Topitschnig wurde schon gefragt, wann diese Maschine denn nun endlich flächendeckend zum Einsatz komme - so plausibel erschien manchen die Darstellung des Schauspielers Werner Wultsch in Topitschnigs 2009 entstandener Mockumentary „rumor macchina".
Richtig schreien
„Die Unmittelbarkeit der Stimme interessiert mich", sagt der 1980 in Rottenmann geborene und in Irdning aufgewachsene Künstler. Bei einem Gespräch im Wiener Café Jelinek - Topitschnig lebt mittlerweile in der Bundeshauptstadt - erzählt er von Schreitherapien, vom Urschrei und von einer Opernsängerin, die Metalbands im richtigen Schreien unterrichtet. Schreit man nämlich falsch, so kann das einiges mit den Stimmbändern anrichten. Schon in der Audioinstallation „Nouvelle Couleur" (2005/2010) arbeitete der Künstler mit Schwerpunkt akustisch-visuellen Medienarbeiten mit drei Sängerinnen. Sie sangen einzelne Töne, so lange ihr Atem reichte.
Es verwundert wenig, dass der Sound eine wichtige Rolle in Topitschnigs Werk spielt, studierte er doch an der Wiener Universität für angewandte Kunst beim Künstler Bernhard Leitner, dessen Raum-Klang-Experimente international bekannt wurden. Zudem unterstreicht Topitschnig die oft wenig beachtete Bedeutung von Ton in filmischen Arbeiten. „Musik und Sound sind sehr wichtig für die Rezeption eines Films oder eines Videos", meint er. „Bestimmte Noten evozieren bestimmte Gefühle."
Bedachter Umgang mit Tönen
Wie bedacht der Künstler mit Tönen und Musik umgeht, zeigt sich in Arbeiten wie „Men And Women Merely Players", wo mexikanische „Lucha Libre"-Player - kostümierte Wrestler, die in ihrem Imponiergehabe miteinander konkurrieren - auf den Plan treten, in „Mark&Garry", einem Film über Totengräber und deren Umgang mit Maschinen, sowie in „Carusel". Letzteres Werk, ein 2017 entstandenes, rund sechs Minuten langes Video, führt in eine rumänische Salzmine, die zu einer Art Erlebnispark umfunktioniert wurde. Grüne Lichter kommen dem Publikum zu Beginn entgegen, es donnert aus der Ferne, aus der Finsternis schälen sich höhlenartige Strukturen. Gerüste im Inneren der Mine erinnern an Piranesis „Carceri", eine irreale Gefängnisvision. Man hört Kinder rufen, Neonröhren strukturieren das Bild und erscheinen wie Lichtkunstwerke. Zum Ende fährt die Kamera nach oben - zum Ausgang diese bedrohlichen Höhle. Das Video, so bemerkte die Kuratorin Marlies Wirth, „triggert zahlreiche Assoziationsketten, zwischen mythischer Überlieferung und realen Ängsten vor Dunkelheit, Untergrund und Ungewissheit."
Gespür für Szenerien
Topitschnig, der den Umgang mit Film und Video auch bei Constanze Ruhm und Thomas Arslan studierte, hat ein Gespür für Szenerien. Kunsthistorikerin Claudia Slanar analysiert: „Topitschnigs entschleunigte Kameraführung sowie die Wahl von statischen Kameraeinstellungen erzeugen starke visuelle Eindrücke. Diese entstehen durch das intensive Beobachten nicht offensichtlicher, aber für die Narration relevanter Details, die sich dadurch überhaupt erst enthüllen."
Nebenschauplätze bei Nacht
Neben seiner künstlerischen Tätigkeit arbeitet der gebürtige Steirer auch als Kameramann und Cutter für das Fernsehen, ebenso für Theaterproduktionen und den Museumsbetrieb. In einer seit 2019 fortlaufend entstehenden Fotoserie mit dem Titel „EXT. NOC" zeigt er Drehorte bei Nacht - ein Friedhof, der von Scheinwerfern erhellt ist, ein Feld, auf dem das Licht diffundiert. Es sind Nebenschauplätze, die üblicherweise nicht in den hier produzierten Filmen oder Fernsehserien vorkommen: Orte, deren Romantik höchstgradig konstruiert ist.
Die offensichtliche Inszenierung von Situationen und Orten, egal, ob mexikanische „Lucha Libre"-Kämpfe oder beleuchtete Filmsets: In Topitschnigs Arbeiten tritt sie zu Tage. Um sie uns vor Augen zu führen, reicht allein seine scharfe Beobachtungsgabe.
 Website von Patrick Topitschnig >>
Website von Patrick Topitschnig >>
Nina Schedlmayer
Stand: September 2021