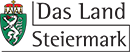29.11.2023: Ein neuer Text von Chrystyna Nazarkewytsch (Literaturstipendium 2022)
Chrystyna Nazarkewytsch: "PERE - MOHA" 29.11.2023
PERE - MOHA
PEREMOHA ist das Wort, das ich in den letzten zwei Jahren als Abschiedsformel, Geburtstagsglückwünsche, intimste Träume, eine Art Mantra und, ja - Zukunftspläne besonders oft höre, denke, selber gebrauche, herbeisehne...
Ich verwende bewusst nicht das deutsche Wort, weil es durch die NS-Geschichte schon genug diskreditiert ist, so dass es sogar mir, einer Ausländerin und Spätgeborenen, mulmig wird, wenn ich das Wort „Sieg" gedruckt lese oder auch höre. Auf Ukrainisch ist das Wort aber für mich nur positiv konnotiert und in der Form, die ich kenne, für das deutsche und österreichische Ohr unbekannt. Vielleicht kann das Wort einmal als Lehnwort das Deutsche bereichern und mehr über die ukrainischen Wünsche erzählen. Dieses Wort bedeutet im Ukrainischen eine Tat, die menschliche Kräfte und Möglichkeiten übersteigt, eine Tat, die unglaublich viele Kräfte abverlangt. Mit Sicherheit wird im Krieg eine Summe der Potentiale vieler Menschen gebraucht, um PEREMOHA zu erreichen. „Gemeinsam sind wir viele, gemeinsam sind wir nicht zu bekämpfen", - haben wir 2004 die graue Spätherbstluft in Kyiw mit unserem Gesang und mit orangefarbenen Bändern, orangefarbener Kleidung, orangefarbenen Mützen und Schals, orangefarbenen Blumen und Make-ups erhellt. Die bunten fröhlichen Menschenströme waren euphorisch und zukunftssicher: wir wussten damals, dass unser gemeinsames Potential eine PEREMOHA bringen wird, wie sicher wir waren, dass mit Lachen und guten Gedanken nur das Gute herbeigerufen werden kann. Wie naiv war unser Glaube damals an die Unmöglichkeit des Bösen in einer Welt, in der Menschen einander verstehen und respektieren. Bereits einige Monate später nannte der Kreml-Chef in seiner traditionellen Ansprache an die Föderale Versammlung den Zerfall der Sowjetunion „die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts" und kündigte somit den nahenden Krieg an, indem er von der Pflicht sprach, die russischsprachigen Menschen außerhalb Russlands in Schutz zu nehmen. In der Euphorie der erfolgreichen Orangen Revolution haben wir über jene Rede gelacht. Wir sahen für uns damals keinen Weg zurück. Russland versucht aber seit 2014, uns gewaltsam auf den Rückweg zu bringen.
Meine DaF-StudentInnen in Lwiw verwechseln oft die deutschen Verben „erleben" und „überleben", vielleicht weil es im Ukrainischen nur ein Wort für beide Bedeutungen gibt. So gesehen bedeutet PEREMOHA in diesem Krieg unser Überleben zu erleben. Ja, am Leben bleiben, nach allen Verlusten beim gesunden Verstand bleiben, das eigene Ich bewahren, weiter Ukrainisch sprechen, Texte auf Ukrainisch schreiben, Texte ins Ukrainische übersetzen, die Ukraine komplett entminen lassen, die roten Beeren des Schneeballstrauchs vom Boden hochheben und die Ukraine erheitern... Das letzte Bild ist übrigens ein Zitat: ein Zitat aus dem seit 2022 seine dritte Geburt erlebenden Lied, einem Lied, das im 1. Weltkrieg ukrainische Soldaten im Königreich Galizien und Lodomerien sangen, die ukrainischen Sitsch-Soldaten, die große Hoffnungen auf das bessere Schicksal ihres Landes nach dem Krieg hegten, die in der Metapher der roten Schneeballbeeren, die man vom Boden heben soll, die verschmähte, verachtete, verkannte Ukraine poetisch priesen, ihrem Land Schutz und Anerkennung versprachen.
Die Sitsch-Soldaten vermochten es nicht, die Ukraine zu erheitern, wie es in ihrem feierlichen Marschlied stand, sie selber wurden vergessen und die Erinnerung an sie wurde in der Sowjetukraine fast komplett ausgelöscht. Ende der 1980er Jahre, 70 Jahre nach dem Entstehen des Liedes, wurde es wieder zuerst leise, dann immer lauter bei den Straßendemos der letzten drei Bestehensjahre der Sowjetunion gesungen, bis die Ukraine wirklich zu einem souveränen Land geworden war, nach Jahrhunderten Freiheitsstrebenversuchen endlich das erreichte, was sich mehrere Generationen offen oder verstohlen wünschten. Das Lied landete wieder in Archiven, weil es nicht mehr aktuell war.
Anfang März 2022 erlebten wir die dritte Geburt des Liedes: der populäre Funk-, Rap- und Rocksänger Andrij Khlywniuk von der Band Bumboks hat es zu einer kecken und dynamischen Coverversion gemacht, zu einem Kampflied bearbeitet, das sofort viral wurde, von allen gesummt und gesungen, allen voran von Kindern - wegen des hinzugefügten schelmischen Doppelausrufs „Hey, hey!". Das war aber noch nicht die Krönung des Erfolgs dieses Liedes: Kaum einen Monat nach dem massenhaften Verbreiten des Liedes in sozialen Netzwerken wurde Andrij Khlywniuk an einem Morgen von David Gilmour angerufen. Jaja, von jenem legendären Pink Floyd-Gitarristen, der dem Ukrainer anbot, eine gemeinsame Single zu mixen. So entstand Hey, hey, rise up, die Single, die Länder, Generationen und Musikrichtungen vereinte und zu einem stolzen und freudigen Zeichen der Solidarität mit der Ukraine wurde. https://www.youtube.com/watch?v=saEpkcVi1d4
Diese schöne Kollaborationsgeschichte fand vor über 500 Tagen statt. Aber es gibt Hunderte ähnliche, wenn auch nicht immer so spektakuläre Geschichten.
Eine PEREMOHA wird schließlich vor allem auf diesem Weg erreicht: wenn Menschen des guten Willens sich zusammentun und im zivilen Leben gemeinsam gegen die Aggressivität des Bösen etwas Gutes tun: Musik machen, Lesungen veranstalten, Bäume pflanzen, Gras mähen, das Gesicht dem Wind entgegenstrecken, Fenster wieder einglasen, Brot backen, Waisenkinder adoptieren, Borschtsch kochen, Felder von Panzerwracks rein machen, unzählige Minen entschärfen, Äpfel ernten, Kindern Gute-Nacht-Lieder vorsingen, Hunde streicheln, technisch immer vollkommenere Arm- und Beinprothesen herstellen, Geliebte umarmen, unbekannten Menschen zulächeln, den Soldaten für ihre Tat danken, Kinder großziehen, Tiere füttern, Bücher schenken, die Gräber der Gefallenen pflegen, atmen, malen, nachts unter dem Sternenhimmel spazierengehen, tagsüber in den blauen hohen Himmel lange und ohne Angst blicken, Vögel zwitschern hören, Gedichte schreiben, mit Kindern zusammen Hey, Hey aus vollem Hals freudig singen, träumen, Zukunftspläne schmieden...
Eine PEREMOHA wartet auf uns in der Zukunft. Noch nie war die Zukunft für uns so erstrebenswert, aber auch so fragil und so unsicher wie jetzt. Noch liegen die roten Beeren wie Bluttropfen in der fetten geschändeten Schwarzerde... Aber wartet nur: Hey hey, die Ukraine wird noch erheitert und zum glücklichen Lachen gebracht.
Schönheit wird die Welt retten, so lautet, glaube ich, der berühmt gewordene Aphorismus des zumindest in Augen der Ukrainer*innen total diskreditierten Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Ein ganzes Jahr schon beschäftigt uns der Gedanke, wie verlogen dieser Satz ist. Begleitet wird er von der Besorgnis, was denn die Situation, in die wir gegen unseren Willen, gegen den gesunden Menschenverstand gedrängt wurden, retten kann. Und - ja! -jeder Tag dieser widerwärtigen, dieser perversen russländischen Gewalt bestärkt uns darin, dass das Allerschönste für uns eine wirksame und ausreichende Menge gelieferter Kampfwaffen ist. Ich schreibe das Schwarz auf Weiß, ich, die ich jahrzehntelang überzeugte Pazifistin war, die fest daran geglaubt hat, mit allen Menschen lasse sich reden.
Okay, okay, natürlich werde ich nicht allen Ernstes behaupten, dass ich die deutschen Leopard-Panzer oder die amerikanischen Artilleriesysteme HIMERS für ästhetisch halte oder dass mich ihr Anblick in eine Art Ekstase versetzt. Nein, ich halte sie für schön, weil sie das einzig Zweckmäßige in unserer Situation sind, einer Situation, die, ich muss das einmal mehr wiederholen, nicht von uns gewählt wurde, eine Situation, in der wir keine andere Wahl haben als uns zu wehren. Die Frage ist aber immer wieder, ob wir genügend Mittel dafür haben.
In Wirklichkeit ist Schönheit natürlich etwas ganz anderes. Endlos schön und rührend kann zum Beispiel eine Haute-Couture-Modenschau der bekannten ukrainischen Modedesignerin Oksana Karavanska sein (https://www.instagram.com/oksanakaravanska/?hl=en). Eine Modenschau im Krieg? Ja, genau, dazu noch im 11. Monat des gelebten Wahnsinns: ein Defilee im vergoldeten Prunksaal der Lwiwer Oper. Wie ist das überhaupt möglich? Die Antwort ist: das Leben im Kriegshinterland wird, wenn auch unter völlig veränderten Umständen, fortgesetzt. Schönheit kann die Welt nicht retten. Sie kann aber die menschliche Psyche vor einem Nervenzusammenbruch bewahren.
Wie sieht denn eine Modenschau während des Krieges aus? Fünf Minuten vor dem Beginn der Performance muss das versammelte Publikum in den Luftschutzkeller hinunter, weil über dem ganzen Land die schrille und immer noch alle Sinne lähmende Luftsirene zu heulen beginnt. Nach rund zwei Stunden im ehemaligen Kellerrestaurant, das heute den Operngästen als Versteck dient, kehren die Zuschauer*innen zurück in den Spiegelsaal des Theaters, um dem ungewöhnlichen Defilee beizuwohnen: die Kreationen der Designerin werden von Balletttänzerinnen gezeigt. Das Eintrittsgeld wurde an die Ukrainischen Streitkräfte überwiesen.
Die Fashion Show in der Lwiwer Oper fand praktisch gleichzeitig mit der Pariser Fashion Week statt, was der Veranstaltung eine gewisse Synchronität mit den Kulturevents in Europa verlieh. Diese Tatsache war ein Trost - zugegeben schwach, aber immerhin - in unserem einsamen zivilisatorischen Kampf. Zarte glatt gekämmte graziöse Tänzerinnen in flachen Ballettschuhen, weißen ätherischen romantischen Tutus unten und kühn geschnittenen, akribisch meisterhaft gestickten Haute-Couture-Blusen oben, in denen das tiefe Schwarz des Grundtons vom zarten, fast unschuldigen Rosa und Beige erhellt wurde, begeisterten mit Ernst und Anmut. Es war eine verwickelte Symbiose der kulturellen Tradition mit der manifestierten und modifizierten nationalen Identität oder, wenn man will, des verletzten nationalen Stolzes. Es war Schönheit pur, aber eine fragile Schönheit, die in Kriegsbedingungen besonders bedroht empfunden wird. Nach dem Verlassen der Oper haben wir von den Folgen des Raketenangriffs auf die Stadt Dnipro erfahren, zwei Stiegen in einem Hochhauskomplex wurden zerstört, 45 Personen getötet, 79 schwer verletzt, über 70 Wohnungen sind nun komplett zerstört, 160 Wohnungen beschädigt und kaum noch zum Leben geeignet ...
Die Nachrichten waren schockierend, besonders nach der Modenschau. Ich erinnerte mich an die beeindruckende Entschlossenheit und Stärke in den Blicken und in der Körperhaltung der Tänzerinnen. Es war keine Unterhaltung, es war eher eine Demonstration des ukrainischen Willens, die Verbindung zum normalen Leben nicht zu verlieren und bis zum Sieg standhaft zu bleiben. Auch musste ich an eine bekannte Balletttänzerin der Kyjiwer Oper denken, die sich in den ersten Stunden des Kriegs als Scharfschützin zur Kyjiwer Territorialverteidigung meldete. Ihr Mann kam vor drei Jahren im hybriden Krieg, der ab 2014 gegen die Ukraine im Osten geführt wurde, ums Leben. Mit dem Beginn des großflächigen Angriffs auf die Ukraine konnte die 30-jährige Frau nicht passiv bleiben, sondern schrieb sich in die Verteidigung ihrer Heimatstadt ein. Sie behauptete, dass sich Ballettartisten besonders gut für eine solche Aufgabe eigneten, weil sie daran gewöhnt seien, Schmerzen auszuhalten und einen starken Geist aufwiesen.
Einen starken Geist demonstrieren zurzeit Hunderte, Tausende hervorragender Menschen. Sie bilden jetzt die Schönheit des Landes. Menschen, die von ihrer Gerechtigkeit überzeugt sind, werden von einer ikonenartigen Schönheit erhellt. Mit jedem und jeder könnte man mehrere Seiten Papier füllen und ihre Geschichten erzählen. Menschen, die wie die Kyjiwer Ballettänzerin ihre Lieblingsarbeit, ihre Kinder verlassen, weil sie verstehen: wenn sie das jetzt nicht tun, werden ihre Kinder zu einem fremden Leben gezwungen und in die düstere Vergangenheit der „Endlösung" der ukrainischen Existenz geworfen.
Ich würde so gerne mehr über diese schönen Männer und Frauen schreiben, nur meine dauernde Angespanntheit hindert mich an der erforderlichen Schreibkonzentration, lässt mich die Gedanken nicht zu Ende führen. Auch diese Zeilen kommen nur mit Mühe zustande. Ich weiß von mehreren ukrainischen Autor*innen, die im Unterschied zu mir professionell schreiben, dass mit dem Krieg das Schreiben für sie fast unmöglich geworden ist. Auf Facebook folge ich dem Kyjiwer Autor Artem Tschech, der noch 2015 ein Jahr lang an der Ostfront verbrachte und seine für einen Intellektuellen so ungewöhnlichen Erfahrungen in einem aufrichtigen und erstaunlichen Buch notierte, das übrigens vor kurzem in der deutschen Übersetzung von Maria Weißenböck und Alexander Kratochwil unter dem Titel Nullpunkt erschien. 2015 wurde Artem einberufen, 2022 ging er als Freiwilliger in den Krieg. Ich weiß, dass er das für seinen 12-jährigen Sohn tut. Sein Schaffen ist zwanghaft gestoppt. Dafür gibt es an der Front sehr wenige Möglichkeiten, wenn überhaupt aber er schreibt kleine Meisterwerke in seinen Facebook-Postings. Hier ein längeres Zitat aus einem der neusten Postings:
....Artem, es gibt ein wunderbares Angebot für Sie. Wollen Sie einen Text für uns schreiben, den wir sofort publizieren werden?
Es gibt nichts, worüber ich schreiben möchte.
Schreiben Sie über die schriftstellerische Tätigkeit und den Krieg, über Ihre Erfahrungen, Ihre Gefühle. Sie haben eine Gabe zur Verallgemeinerung, das ist sehr wertvoll.
Wertvoll kann eine neue Trainingshose sein und wenn der Rücken nach der Schutzweste ohne Schmerzen hält. Wertvoll sind die auf Papier geschriebenen Briefe und Postkarten, die ich erhalte. Mit Worten und Zeichnungen. Mit Düften und Wünschen. In Liebe und im Glauben, dass meine Existenz wichtig ist.
Artem, was haben Sie im Krieg Neues gelernt?
Ich habe keine infantilen Forderungen an das Leben mehr.
In den Kommentaren unter diesem Posting schreiben unterschiedliche Menschen aufgeregt, wie wichtig Artems Formulierung über den Abschied vom Infantilismus ist. Ich verstehe diesen Abschied sehr gut. Der Krieg hat uns vom verlogenen Pazifismus geheilt. Wir, die wir uns für Intellektuelle halten, haben begeistert Habermas und Co. gelesen, haben geglaubt, dass der Frieden dann möglich ist, wenn Menschen miteinander kommunizieren. Unser amtierender Präsident, dessen Mut jetzt die Welt applaudiert, wurde mit einer überwältigenden Stimmenmehrheit gewählt, weil er in der Wahlkampagne seinem Rivalen, dem Ex-Präsidenten, lustig und frech einen Rat erteilte: „Sie können den Krieg im Osten nicht beenden. In Wirklichkeit ist alles einfach: man soll nur aufhören, aufeinander zu schießen". Jetzt, gerade gestern, hat dieser Mann, der mit Sicherheit keine infantilen Forderungen mehr ans Leben stellt, im britischen Parlament Kampfjets gefordert und nannte sie „Flügel für unsere Freiheit".
Die Freiheit der schönen Menschen steht unter der größten Gefahr seit über 300 Jahren. Alles erinnert an die höchst dramatischen literarischen oder cineastischen Geschichten der Weltrettung in letzter Sekunde. In Filmen macht das fast immer ein einzelner Held. Wir leben jetzt unter dem Schutz Tausender Held*innen, die mit aller Entschlossenheit bereit sind, die Welt unter Aufopferung ihres eigenen Lebens zu retten, uns die Möglichkeit zu gewähren, bei einer Modenschau oder bei einer Lesung, einem Film im Kino neben anderen ungestört zu sein. Ob sie noch genug Kraft haben? Ob die schwarze Flut des Bösen sie nicht auslöscht? Die Welt hat heute eine Chance, mit ihrer Unterstützung eine wiederholte Tragödie zu vermeiden, den zweiten Holocaust zu verhindern.
Der Sekundenzeiger der Weltuntergangsuhr tickt.
Ich wache in der morgendlichen Dunkelheit auf und tappe durch die Wohnung in die Küche. Zögere einen Moment, dann strecke ich meine Hand aus und drücke den Lichtschalter. Das Aufleuchten der Lampe versetzt mich in einen Zustand wahren Glücks: Ich stehe eine Weile bewegungslos und starre verliebt das Lampenlicht an. Dabei gab es noch keinen richtigen Blackout in der Stadt. Der Rhythmus der Stromein- und -abschaltungen soll im 8-Stunden-Takt geschehen: 8 Stunden ohne Licht von etwa 4:30 morgens an, um 12:00 sollte der Strom wieder da sein, aber in Wirklichkeit fließt er erst um 14:00 wieder und das erschrockene Glück dauert nur bis 18:00. Danach kommt eine Zeit, die fast rührend in ihrer Intimität ist: Man zündet Kerzen an, schaltet Taschen- und Stirnlampen ein, stellt eine Gaslampe auf den Tisch. All diese Lichtquellen geben ein mildes, diffuses flackerndes Licht, in dem die Gestalten in der Dunkelheit verschwimmen und nur die Gesichter deutlich, etwas geheimnisvoll und sehr vertraut erscheinen. Es ist die Zeit einer lange nicht mehr erlebten Nähe: Man bleibt öfter zu Hause, weil es draußen zu dunkel und zu unsicher ist. Die Gespräche im Dunkeln sind viel offener, gedämpfter, daher zärtlicher und friedlicher. Man hat plötzlich viel Zeit füreinander. Ich entdecke eine neue Leseart. Mein persönliches Know-how der Konzentration ist jetzt das Lesen mit Stirnlampe. Im Hintergrund spricht eine Stimme im Radio, und man weiß so, dass es die Welt draußen immer noch gibt. Den gewohnten Straßenlärm gibt es fast nicht mehr, dafür hört man bis in den späten Abend hinein Generatorengeräusche. Bald werden sich die Ukrainer*innen mit den Marken und Kapazitäten der Stromgeneratoren, von denen viele erst diesen Herbst erfahren haben, nicht schlechter auskennen als mit den Bezeichnungen für die Waffen, über die ukrainische Streitkräfte verfügen. Manche der Waffennamen sind so populär, dass einige der 2022 geborenen Kinder nach ihnen benannt werden. Zu den populärsten gehören Javelin und Javelina, nach der tragbaren Panzerabwehrwaffe, die in den ersten Kriegswochen zum Symbol des Widerstandswillens und zum wichtigsten Kampfmittel der ukrainischen Soldat*innen wurde und viele Leben rettete.
Die treffendste Metapher dieses Kriegs ist die der Bekämpfung der Dunkelheit. Und jetzt, wo wir buchstäblich in der Dunkelheit um ein bisschen mehr Licht ringen, ist unsere Existenz zum Bild der Menschen in diesem Krieg geworden: es ist dunkel und kalt, es ist alles andere als komfortabel, aber der Gedanke an die Verteidiger und Verteidigerinnen des Landes wärmt und gibt Licht. Man weiß, dass sie uns, solange sie leben, verteidigen werden. Und eine alles übersteigende Dankbarkeit verdrängt die Dunkelheit aus unseren Gedanken, verleiht uns Zuversicht und Hoffnung auf ein nicht zu langes Tappen im Dunkel.
Vor sieben Jahren, als der Krieg in der Ukraine, den man im Westen damals noch ziemlich stur für einen Regionalkonflikt hielt, erst ein Jahr dauerte, hat das inzwischen weltbekannte ukrainische Künstlerpaar Romana Romanyschyn und Andrij Lesiw, die unter dem Künstlernamen Agrafka tätig sind, das düstere Kinderbuch „Als der Krieg nach Rondo kam" geschrieben und illustriert. Damals löste das Buch kontroverse Diskussionen aus, ob man den Kindern solch schreckliche Bilder und Inhalte (und die sind schrecklich) zumuten darf. Heute, wenn Dutzende psychologische Ratschläge erscheinen, wie man den Kindern den - völlig realen - Krieg erklären kann, ist das Buch wichtiger denn je. Das Kinderbuch endet mit dem Sieg des Lichts über die böse Dunkelheit. Das Buch zeigte damals. vor sieben Jahren, die Welt im Krieg, warnte vor dem Verlust des Lichts und endete schließlich glücklich: das Licht und damit die friedliche Welt wurde gerettet. Vor den Protagonist*innen im Buch stehen aber noch sehr viele Herausforderungen. Ihre komplett zerstörte Welt muss wieder aufgebaut werden. Das Buch wurde mehrfach übersetzt, darunter in den USA und in Deutschland (Verlag Gerstenberg):
 https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/romana-romanyshyn/how-war-changed-rondo/
https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/romana-romanyshyn/how-war-changed-rondo/
Vor paar Tagen kam mir eine rührende Lesung des Buches in einem belgischen Sender unter die Augen:
In dieser Sendung traf mich das besorgte traurige Gesicht des Buben ins Herz, der bis jetzt mit Sicherheit nie an einen Krieg gedacht hat und dessen Empathie es ihm erlaubt mitzufühlen. Wahrscheinlich ist jetzt das unsere wichtigste Aufgabe: Den Menschen deutlich zu sagen, dass das Leben ohne Licht nur dann möglich ist, wenn man Licht im Herzen hat und Hoffnung darauf, dass der Dunkelheit bald ein Ende gesetzt wird.
Seit über 200 Tagen stelle ich mir immer wieder die Frage: Was ist mit Gott eigentlich? Warum hüllt er sich in Schweigen und tut, als ob es ihn nicht gäbe? Ich weigere mich, Gott zu verstehen. Und ich wundere mich über die, die immer noch Russland verstehen wollen. In diesen Kriegstagen habe ich aber Antwort auf die Frage bekommen, die einmal ein deutscher Philosoph stellte: Wozu Dichter in dürftigen Zeiten? Der Schmerz, den heute die meisten spüren, ist nicht mehr in Worten zu fassen oder in Bildern zu zeigen. Aber wenn Worte zu Chiffren werden, können sie sehr viel von der unglaublichen Situation in einem Land erzählen, das von Gott in Stich gelassen wurde.
Die Dichterin, die in letzten Jahren zu den mächtigsten poetischen Stimmen der Ukraine gehört, reagierte auf die grausamen Nachrichten aus der befreiten Geisterstadt Isjum sofort, in der Nacht schrieb sie ein bis markerschütterndes Gedicht, ein Gebet, das ich auch sofort übersetzen musste:
Kateryna Kalytko
September 2022, Nacht·
Vater unser,
der du bist
in den unbefiederten Herzen,
in den mit Draht zusammengebundenen Armen,
im trockenen Lehm unter den Nägeln,
in den ungehobelten Brettern der Kreuze.
Geheiligt werde
jeder aufgefundene Name,
jeder Schmerzbrand am Rande der Grube,
jeder vergilbte Fetzen Haut,
und jener Soldat, der sich erbricht unter den Kiefern,
und dann zurückkehrt, um weiter zu graben.
Unsere Armee
soll kommen.
Menschen in weißen Monturen
sollen kommen.
Internationale Rechtsanwälte
sollen kommen.
Unsere untröstlichen Verwandten
sollen kommen.
Wie im Himmel so auf Erden soll es eng sein
von unserem stummen Schrei,
im redlichen Licht unseres Hasses
kann man bis drei Generationen nach vorne sehen.
Gib uns täglich
Vor- und Familiennamen,
sie sollen auf Gräbern geschrieben stehen,
gib uns unsere Köpfe zurück,
unsere Gesichter,
und unsere Tätowierungen.
Und vergib uns nichts, auch wenn du es wolltest -
weil auch wir nicht vergeben unseren Schuldigern,
wir stehen vor deinem Jüngsten Gericht
wie ABC-Schützen an der Tafel,
mit aufgeschlagenen Seelen,
die mit blutiger Tinte eng beschrieben sind -
lauter Lehrereinträge.
Aber führe uns nicht zum Verhör
in die Folterkammer im Keller,
lege uns nicht in die von Fremden ausgestampfte Erde,
ins Finsternis der Geschichte,
in Vergessenheit.
Aber erlöse uns
vom Körperwissen,
nimm uns das Geräusch der zerdrückten Wirbeln,
das Knacken der zerbrochenen Kniescheiben,
die zerschnittenen Sehnen,
das leisen Rauschen des Bluts,
erlöse uns vom Klumpen
in den Mündern, die mit Erde verstopft sind.
Denn dein ist der Krieg, und das Tier, und die Macht, und der Ruhm,
und die Exhumierung,
und der schwere Dunst über dem Grab,
in dem Vater und Sohn
gemeinsam verscharrt wurden.
Heute, und jederzeit und in aller Ewigkeit.
Wir haben das Gebet gut gelernt.
Warum stellst du uns
keine Fragen?
Ist das eine Einschlagstelle?
nein, da bricht eine Baumwurzel durch den Asphalt
Kommt da eine Rakete geflogen?
nein, ein Biker heizt mit lautem Motor durch die Straße
Schreit da ein Verletzter?
nein, da quengelt ein Kind tränenüberströmt nach dem dritten Eis
Ist Krieg?
nein, das ist friedliches Leben
mach dir keine Sorgen! Treffer gab es in der Früh
(Pawlo Korobtschuk/ Kyjiw Juni 2022,
aus dem Ukrainischen von mir übersetzt, - Ch.N.)
Nach zwei weit weg vom Krieg verbrachten schönen und vor allem ruhigen Wochen brauchte ich Zeit, um unsere Situation zu analysieren. Ich musste gegen meine dumpfe Verzweiflung ankämpfen, die angesichts der vergangenen fünf und der noch kommenden, in ihrer Zahl unvorhersehbaren Kriegsmonate in mir hochstieg. Es ist verlorene Lebenszeit für Kinder, die nicht geboren bzw. nicht erwachsen werden. Es ist verlorene Familienzeit für Kinder, die ein Elternteil oder auch beide Eltern verloren haben. Es ist verlorenes Familienglück für junge Kriegswitwen. Es ist verlorene Wohlstandszeit für Menschen, die jahrelang für ihre Traumwohnung gearbeitet und gespart haben und jetzt obdachlos geworden sind. Es ist verlorene Zeit für Bücherliebhaber:innen, die heute kaum Bücher lesen können, die ratlos vor ihren Büchersammlungen feststellen müssen, dass im schlimmsten Fall das Meiste der kostbaren jahrzehntelangen Sammlung im zerstörten Haus bleiben und nicht überdauern wird. Es ist verlorene Zeit für die neuen Straßen im Land, die in der Corona-Zeit in der Ukraine intensiv gebaut wurden, damit endlich das Klischee von schlechten Straßen (das Regiedebüt der ukrainischen Dramatikerin Natalia Worozhbyt mit eben diesem Titel Bad Roads ist übrigens nur für Menschen mit starken Nerven zu empfehlen) zur Vergangenheit wird. Es ist verlorene Zeit für das Land, das endlich einen eindeutigen Kurs in Richtung einer sicheren fortschrittlichen Entwicklung eingeschlagen hatte. Diese gewaltsame Unterbrechung von ersten, bereits sichtbaren Erfolgen macht besonders ratlos. Ob wir diesen Rückschlag nach dem Krieg wieder schnell gutmachen können?
Postsowjetische Länder brauchten schon einige Zeit, um sich von der Last der sowjetischen Gräue und Beklemmung zu befreien. Die 1990er Jahre waren für uns ein Horror, man sollte so vieles überwinden: wir hatten keine Währung, keine Löhne, keine Arbeit, keine Gerechtigkeit. Racketeering, den man vorher nur aus amerikanischen Kriminaldramen kannte, wurde zum ukrainischen Alltag. Die Migration war enorm, und gerade in den ersten Jahre der Unabhängigkeit wurde die Entschlossenheit der Ukrainer:innen, unter vollkommen anderen Regeln als bisher weiter zu leben, auf die Probe gestellt. Wir haben diese Probe bestanden.
Man kann über 20 Jahre des ständigen Wachstums und der stetigen Verbesserung des Lebensstandards in der Ukraine sprechen. Jetzt, nach dem 24. Februar 2022, schwärmen wir von den vergangenen zwei Jahrzehnten, erst jetzt verstehen wir, wie viel, besonders im Vergleich zu der Ruine der 1990-er Jahre, in der Ukraine erreicht wurde: wie gelassener und weltoffener die Ukrainer:innen wurden, wie intensiv neue, wichtige und hervorragende, Bücher und Übersetzungen in ukrainischer Sprache veröffentlicht wurden, wie ungeheuer die Unterhaltungsbranche boomte, mit all den einmaligen Kaffeehäusern und Lokalen und Dutzenden ausgefallensten Festivals, welchen erstaunlichen 7-Meilen-Fortschritt der Tourismus machte, sowohl der aus dem Ausland als auch der im Inland. Wir haben ja bis vor kurzem das eigene Land kaum gekannt: so viele Ukrainer:innen haben die halbe Welt bereist und dabei nicht einmal die Nachbarorte in der Ukraine besucht. Erst vor einigen Jahren begann das touristische Unternehmen unter dem Markennamen Ukraїner die interessantesten und ungewöhnlichsten Orte in der Ukraine und deren Bewohner:innen den Landsleuten vorzustellen. Wie wenig wir voneinander wussten, wie fest gelang es der sowjetischen, lies: russischen Macht uns von unserer Nichtigkeit zu überzeugen. Wir hatten uns selbst fast das ganze 20. Jahrhundert nicht bemerkt, unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Einzigartigkeit wurde in der Sowjetzeit komplett entwertet - für uns selbst und für die Welt. Umso erstaunlicher war das in den letzten Jahren Vollbrachte: Die Ukrainer:innen wurden endlich auf sich selbst neugierig. Doch erst der Krieg machte uns mit eigenem Land bekannt: viele haben zum ersten Mal die Namen der Orte gehört, die jetzt wegen der russischen Kriegsverbrechen weltweit bekannt sind. Viele wiederholen jetzt wie ein Mantra das Versprechen: wenn das friedliche Leben beginnt, werden wir als erstes die Ukraine bereisen, wir werden uns zerstörte, verletzte, kontaminierte Landschaften aneignen und sie wieder beleben.
Noch 2014, als der Krieg im Donbass ausbrach, haben Dutzende Tausende ihre Häuser, ihre Wohnungen in besetzten Orten verlassen und sind in die geographisch westlicheren Städte der Ukraine umgesiedelt, wo sie, im Vergleich zum Wahnsinn der selbsternannten „Republiken", ein friedliches Leben fortsetzen konnten. Ein friedliches Leben im Krieg klingt nach Oxymoron, aber wir müssen zugeben, dass nicht nur die Welt, sondern dass auch wir den Ernst der Lage in vergangenen acht Jahren unterschätzt haben. Andererseits bzw. vor allem ist es unser Selbsterhaltungstrieb. Auch heute, in den Pausen zwischen den Luftsirenen, leben wir ein gewöhnliches Leben weiter, obwohl es allen klar ist, dass unsere Situation alles andere als gewöhnlich ist.
Erst wieder zu Hause nach meiner Auslandsreise habe ich verstanden, was denn so gut und leider, solange es Krieg gibt, bei uns unerreichbar ist: im Westen bin ich so weit gegangen, wie viel Kraft ich hatte; in der Ukraine, in meiner Geburtsstadt Lwiw gebe ich mir Mühe, nicht weiter als 10 Minuten Fußweg von einem bekannten Bunker entfernt zu sein, damit ich im Fall eines Luftalarms möglichst schnell in Sicherheit kommen kann. Im Westen genießt man die Umwelt mit allen dazu gehörenden Geräuschen, zu Hause in Lwiw habe ich bei mir und bei den Menschen, die draußen sind, etwas Gemeinsames bemerkt: bei jedem lauteren oder nicht auf Anhieb identifizierbaren Geräusch gehen alle kaum sichtbar in die Knie und erstarren für einen Moment, bis es klar wird, dass das Geräusch keinen Luftalarm bedeutet, dass es keine entfernte Explosion und auch nicht der Beginn eines Beschusses ist. Auf die Dauer ist solch ein angespannter Zustand recht quälend. In großen westlichen Städten wimmelt es von Touristen. In Lwiw gibt es trotz des Hochsommers keine Touristengruppen, obwohl auch ohne Touristen recht viele Menschen draußen sind, wir haben ja die meisten Binnenflüchtlinge in der Stadt.
Die zwei Wochen im Ausland waren schön, aber die Ruhe dort machte mich umso unruhiger. Ich musste nach Hause, es war eine dringende innere Forderung, dass man auf die eigene Heimat quasi aufpassen soll. Dass man zu Hause für das friedliche Leben jetzt und vor allem nach dem Krieg sorgen muss. Ohne Menschen ist das friedliche Leben nicht wiederaufzubauen. Und eben darum kämpfen Ukrainer:innen nicht mehr metaphorisch, sondern real: um unser friedliches Leben und die ganze Zeit der Welt, die für Kinder, Bücher, Touristenrouten, Haustiere, Kaffeehäuser, Museen, Theaterfestivals, Open-Air-Konzerte und vieles, vieles mehr bestimmt wird.
Ich wollte diesen Text schon beenden, als youtube mir ein Video aus Charkiw vorschlug, ein wunderbar rührendes, sehr gut gemachtes kurzes Video der Filmgruppe Babylon'13, die in der Ukraine seit Euromaidan wirkt. Der Film ist mit „Skateboarding an der Frontlinie" betitelt: eine Gruppe junger Skater macht unterschiedliche Tricks auf ihren Skateboards. Die Teenager erzählen, wie sie die Kriegszeit in der Stadt, die nicht mal 40 km von der russischen Grenze entfernt ist, empfinden. Sie skaten vor dem beschädigten Theater, rollen an zerstörten Häusern vorbei. An der Wand eines zerbombten Hauses stehen drei Wörter: [Die] Zeit hört uns. Ich erkenne die Hand des Graffiti-Künstlers: Das hat Hamlet gesprayt, der bekannteste Charkiwer Straßenkünstler. Auch er, wie etwa Serhij Zhadan oder die Jugendlichen im Video, ist in der Stadt geblieben. Er lässt seine Kunst nicht. Er verlässt seine Stadt nicht. Zum Schluss sagt ein Skater im Video: „Vor dem Krieg dachte ich nicht, dass ich den so großen Wunsch haben werde, in der Ukraine zu bleiben. Ich dachte, dass ich, wenn ich groß bin, irgendwohin nach Europa ziehen und dort leben werde. Jetzt will ich von hier nicht weg. Jetzt spüre ich viel stärker als früher, wo mein Zuhause ist, und es ist sehr wichtig für mich."
 https://www.youtube.com/watch?v=A8IcH2-6k6Q
https://www.youtube.com/watch?v=A8IcH2-6k6Q
Inter arma silent musae -
ich höre den Pfarrer diesen Satz zu Beginn seiner Totenrede sagen. Er spricht über die Verstorbene, deren Asche in einer Urne auf dem zierlichen Tisch in der Kirche steht. An die Urne gelehnt ist ihr Bild: es war eine große Frau mit großen Augen, großem, vollen Mund, starken Augenbrauen, breitem Lachen und gesunden Zähnen. Ich habe sie nicht gekannt, obwohl ihre jüngere Schwester eine gute Freundin von mir ist.
Beide Schwestern waren Schülerinnen der berühmten musikalischen Internatsschule in Lwiw, ihre Mutter, eine früh verwitwete Bergbewohnerin in einem Karpatendorf, hat sich entschieden, ihre begabten Kinder für zehn Jahre in die 250 Kilometer entfernte Stadt zu schicken, obwohl in ihrem Bauernhof sicher jedes Paar Arbeitshände von Bedeutung war. Die liebende Mutter hat auf den Rat des Dorflehrers gehört, der das Talent der Kinder erkannte: beide sind wichtige ukrainische Komponistinnen geworden, beide wurden für ihr Schaffen mit dem wohl renommiertesten Künstlerpreis der Ukraine, dem Shevchenko-Preis, ausgezeichnet. Zuerst die ältere Schwester, einige Jahre später die jüngere. Jetzt nehmen wir in der orthodoxen Johannes-Kirche Abschied von der älteren, deren Asche von Kyiw nach Lwiw, dem Wohnort der jüngeren, gebracht wurde. Die Beerdigung findet anderthalb Monate nach deren Tod statt, was nicht der ukrainischen Tradition entspricht: die Ukrainer beerdigen ihre Toten am dritten Tag - als Symbol des Übergangs vom Tod zum ewigen Leben wie bei Christus. Oder sollte man sagen: die Ukrainer beerdigten ihre Verstorbenen vor dem Krieg am dritten Tag? Jetzt ist alles anders, auch der Abschied. In diesen drei Monaten gab es allerdings so viele Tote, die man nicht beerdigen konnte, Tote, die wochenlang auf den Straßen ihrer Wohnorte oder in ihren zerbombten Wohnungen lagen, bis sie ihre letzte Ruhe fanden. Tote, die, in Massengräbern verscharrt, exhumiert werden mussten, damit der gewaltsame Tod dokumentiert werden konnte, als Beweis der Kriegsverbrechen in der Ukraine. Im Jahr 2022, 77 Jahre nach dem Ende des letzten - wie man mit Sicherheit glaubte - Kriegs auf dem Kontinent.
Die Schwester meiner Freundin ist am 5. Kriegstag gestorben. Sie wurde nicht mit einem Geschoss getötet, sie starb an Entsetzen in ihrer Wohnung im 15. Stock eines Hochhauses in der ukrainischen Hauptstadt. Die ersten Tage der Invasion waren für die Kyiwer eine Hölle, die Menschen hörten um ihre Häuser herum ununterbrochen Explosionen, man konnte Entfernung und Gefahrenstufe nicht richtig einschätzen. Am ersten Kriegswochenende gab es in der Stadt Straßenkämpfe. Die Bewohner wurden zum tagelangen Ausharren in U-Bahn-Stationen oder Luftschutzkellern aufgefordert. Das Herz der 63-jährigen Komponistin hat die psychische Folter nicht ausgehalten. Sie, deren schöpferische Höhepunkte Kirchenchöre waren, in denen sie nach modernen Harmoniegesetzen suchte, die zu den schönsten in der neueren ukrainischen Musik gehören, konnte die Disharmonie des Krieges, die Kakofonie des Artilleriebeschusses, das Verzichten auf Gottesgebote, die Schrecken des vorgeführten Weltuntergangs nicht überleben.
Ich stehe in der Kirche und lausche dem engelsgleichen Gesang der Seminaristen. Die Tenorstimmen - die Ukraine war seit jeher für ihre hervorragenden Tenöre bekannt - beruhigen, die Worte des Gesangs wirken hypnotisch: Ich weine und schluchze und denke über den Tod nach. Für eine Weile beruhigt der Gesang tatsächlich, ich halte in meinem Hadern mit Gott kurz inne. Aber dann tritt der Pfarrer nach vorne, sagt mit seiner traurigen, tiefen Stimme: Inter arma silent musae, zeigt auf die verdeckten hohen Bogenfenster und bringt zum Ausdruck, dass er um seine schöne, in der Ukraine einmalige neugotische Kirche aus gebrannten Ziegelsteinen bangt: die Glasmalereien wurden Ende des 19. Jahrhunderts in der berühmten Mayer'schen Hofkunstanstalt in München hergestellt. Die Kirche, die ursprünglich den Franziskanerinnen gehörte, hat zwei Weltkriege und die der Kirchenkunst feindselig gesinnte Sowjetmacht überlebt. Spätestens seit dem ersten Raketenangriff auf Lwiw werden in der Stadt Kunstwerke geschützt: vermummte Skulpturen werden in eine Art Käfig geschlossen, Fenster mit Glasmalerei mit Blech- oder zumindest Sperrholzplatten geschützt. Die meisten Museen der Stadt sind geschlossen, weil die Ausstellungsstücke in Sicherheit gebracht wurden. All diese Schutzmaßnahmen sind beinahe rührend in ihrer Hilfslosigkeit. Man weiß ja, dass die erst vor kurzem - nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg - wiederaufgebaute schöne südliche Stadt Mariupol in Trümmern liegt. Man hört erschreckende bis lächerliche Geschichten über Plünderungen durch das russische Militär.
Ja, wir lachen über die mitgenommene Unterwäsche, über gestohlene Waschmaschinen mitten im Feld bei den Schutzgräbern der toten Russen, Fragmente der Telefongespräche, bei denen die Freundinnen der russischen Soldaten Stabmixer, Fön oder neuere Smartphon-Modelle „bestellen". Aber leider hat dieser Krieg in der Regel grausame Sujets. Seit einigen Wochen wird Butscha entmint, die Kleinstadt bei Kyiv, die vor einem Monat zahlreiche Bilder der Grausamkeit gegen zivile Einwohner:innen lieferte. Nach dem Zurückdrängen der Besatzertruppen stellte sich heraus, dass die Stadt mit Minen buchstäblich gespickt ist. Die werden mittlerweile an den ungewöhnlichsten Orten entdeckt. Neulich fand man eine im Korpus des Klaviers einer Schülerin. Es steht, scheinbar unberührt, mitten in der ausgeplünderten Wohnung der Familie, der es gelang, sich rechtzeitig aus Butscha zu retten. Auf dem Klavierdeckel mehrere nette Sachen der 10-jährigen Besitzerin - vom Spielzeug bis zu Auszeichnungen der Musikschule. Nachdem die Russisten eine Granate im Klavierkorpus befestigt hatten, machten sie den Deckel ordentlich zu und stellten alle Gegenstände auf ihren alten Platz zurück. Die Besatzer, Vertreter der berüchtigten Kulturnation, waren wohl stolz auf ihre Idee, vielleicht platzten sie sogar vor Lachen, als sie sich die Szene vorstellten: die Familie kommt zurück in ihr Haus, das Mädchen läuft freudig zum Klavier, das sie seit Wochen vermisste, öffnet es und schlägt auf die Tasten ...
Im Westen der Ukraine, wo ich wohne, verfolgen wir solche Geschichten mit erstarrtem Blut in den Adern. Wir haben ja Geschichten ganz anderer Art zu bieten. Etwa wie Menschen, die ein Klavier besitzen, Kinder von Flüchtlingen zu sich einladen, damit sie einige Stunden üben können. Die Stunden werden genau eingeteilt, damit möglichst viele Kinder, die ihr Klavier entbehren, nicht aus der Übung kommen. Oder die Geschichte von dem Studenten des Lwiwer Konservatoriums, der ein Klavier zum Bahnhofsplatz brachte und zwei Monate lang, während der Flüchtlingsflut, die nach Lwiw bzw. über Lwiw nach Westen strömte, täglich mehrere Stunden vor dem Hauptbahnhof in Lwiw spielte, um so den Ankommenden das Gefühl der Geborgenheit zu verleihen. Einige Minuten auf Instagram genügten, um @Alex Karpenko weltweit bekannt zu machen: Die Musik wird vom Heulen der Sirenen begleitet, der Pianist beachtet sie nicht, spielt fortissimo, er ist nur um eins bemüht - den Menschen um ihn herum die Angst zu nehmen, sie zu trösten und zu beruhigen.
Während ich an diesem Text schreibe, findet in der Lwiwer Philharmonie das traditionelle Musikfestival Virtuosen statt. Heuer ist das Motto: Die Musen in der Ukraine schweigen nicht. An den Wänden des Konzertsaals stapeln sich Kisten mit humanitärer Hilfe, die in Pausen zwischen Konzerten und Proben sortiert und weiter an die Front bzw. in die bedürftigen Orte geschickt werden. Am ersten Tag des Festivals wurde Mozarts Requiem aufgeführt, zum Andenken an Tausende Tote in diesen drei Monaten. Gleich zu Beginn ertönte eine Luftsirene und das Konzert wurde für vierzig Minuten unterbrochen. Alles geschah wie im Teaser des Festivals: eine Luftsirene, die sich in Klängen der klassischen Musik auflöst. Am zweiten Tag des Festivals fand im Saal der Philharmonie eine Weltpremiere statt: das in Kriegsmonaten zu Ende geschriebene Cellokonzert meiner Freundin, der Komponistin Bohdana Frolyak, der der Krieg ihre ältere Schwester nahm. Die Musik symbolisiert schließlich den Sieg des Lichts über die Dunkelheit. Nein, die Musen schweigen nicht.
 Unter dem Link kann man den zweiten Festivaltag miterleben. Mit der Weltpremiere wird das Konzert abgeschlossen: das Cellokonzert von Bohdana Frolyak beginnt ab der 50. Minute der Aufnahme.
Unter dem Link kann man den zweiten Festivaltag miterleben. Mit der Weltpremiere wird das Konzert abgeschlossen: das Cellokonzert von Bohdana Frolyak beginnt ab der 50. Minute der Aufnahme.
Das Mädchen war allein zu Hause, seine Eltern waren Essen holen gegangen und blieben sehr lange weg. Es dämmerte schon und das Mädchen wollte rausgehen, um nach den Eltern zu schauen, schaltete das Radio ein und hörte: „Bleib zu Hause, Mädchen, schließe alle Fenster, schließe alle Türen, da draußen lauert der Fliegende Arm, warte, bis deine Eltern zurück sind." Das Mädchen schloss die Fenster, schloss die Türen und wartete. Nach einiger Zeit öffnete es den Vorhang einen Spalt und sah direkt vor der Fensterscheibe den Fliegenden Arm. Das Mädchen zog den Vorhang schnell wieder zu und versteckte sich in eine Ecke. An der Haustür klingelte es. Das Mädchen dachte, es seien die Eltern, ging zur Tür, schaute aber zuerst durchs Guckloch und sah vor der Tür den Fliegenden Arm, der seine Finger nach ihm ausstreckte. Das Mädchen öffnete nicht und versteckte sich unter dem Bett. Es hämmerte lauter und lauter an der Tür. Das Mädchen unter dem Bett rührte sich nicht und wagte es kaum zu atmen. Allmählich wurde es still draußen. Die Stille tat gut, das Mädchen wagte es endlich, unter dem Bett hervorzukriechen. Es beschloss, sich schlafen zu legen, in der Hoffnung, am Morgen seien die Eltern wieder zu Hause und alle Schrecken weg. Es zog seinen Pyjama an und legte sich ins Bett. Es war erleichtert, im eigenen Bett liegen zu können, dort fühlte es sich endlich sicher. Plötzlich regte sich etwas neben dem Mädchen, und ehe es aufschreien konnte, klammerten sich die Finger des Fliegenden Armes in seinen Hals - - - -
Die Augen meiner Freundin weiten sich, ihre Stimme, die bisher tief und leise war, wird laut und schrill. Wir - neun Jahre alt, in der Grundschule - schreien erschrocken mit.
Meine Schulfreundin erzählte solche Horrorgeschichten meisterhaft. Sie machte lange Pausen und modulierte ihre Stimme vom Flüstern bis zum Schrei, sie quälte uns kleine Zuhörer und Zuhörerinnen mit dem unerträglichen Warten auf den Schrecken. Mit Geschichten über das Weiße Klavier mit blutenden Tasten oder den Schwarzen Mann, der sich gleichzeitig an mehreren Orten aufhalten kann, oder die Schwere Wolke, die über einer Stadt tiefer und tiefer sinkt ... Alle diese Geschichten waren schrecklich, ich wollte am liebsten weglaufen und mir die Ohren zudrücken, aber mein Wunsch, cool zuzuhören und in unserer Kindergesellschaft keine Angst zu zeigen war noch größer als der Drang zu flüchten. Den größten Eindruck auf mich machte jedes Mal die Geschichte vom Fliegenden Arm. Wenn meine Freundin sie erzählte, sie wiederholte die Geschichten ab und zu, konnte ich in der Nacht nicht schlafen. Ich lag im Bett, die Decke über den Kopf gezogen, und horchte in die Stille. Dieses Warten auf den Schrecken war schrecklich.
Diese Grundschulgeschichte holte mich vorigen Montag ein, als Bilder aus der befreiten Kleinstadt Butscha im Kyjiwer Vorort der breiten Öffentlichkeit zugänglich wurden. Die blauen Hände, die aus einem der Massengräber lugten. Der Hund, der am Leichnam seines Besitzers wartete. Die im Rücken mit Klebestoff zusammengebundenen Hände der Opfer, die nach den Folterungen durch einen Kopfschuss getötet wurden ... Als ich mir das Entsetzens der Menschen vorstellte, die bis zuletzt nicht glauben konnten, dass Menschen anderen Menschen gegenüber zu solchen Gräueltaten fähig sind, wurde mir schwindlig. Ein stummer Schrei schnürte mir den Hals zu. Und dann sah ich ihn, den Arm einer Frau. Man konnte ihren Körper nicht sehen und ich glaube, ich weiß, warum. Die Bilder wurden mit großer Achtung vor den Gefühlen der Lebenden gemacht, das Grausamste blieb hinter dem Bild. Der linke Frauenarm in Butscha ist grausam, ich weiß, dass ich diesen Arm nie mehr loswerde. Ich schließe die Augen und sehe diesen leblosen, einst graziösen Arm im Schlamm liegen. Ich schaue meinen eigenen Arm an und er verwandelt sich in einen kotbespritzten Arm, der nicht mehr mir gehört. Vor Müdigkeit schlafe ich ein und sofort erscheint vor mir dieser schmutzige linke Arm einer unbekannten Frau aus Butscha, er fasst mich an der Schulter, rüttelt mich, stößt mich: Vergiss mich nicht, denk an mich, an mich und an die anderen Opfer, lass nicht zu, dass Menschen uns vergessen, von uns wegschauen.
Nicht wegzuschauen ist eine schwierige Aufgabe, die Disziplin und Mut verlangt und auf jeden Fall das Verlassen der Komfortzone erfordert. Nicht wegzuschauen ist unabdingbar, um nicht zu vergessen, wie scheinbar gewöhnliche Menschen zu Unmenschen werden. Ich glaube, wir Nachkommen der Kriegsopfer der 1940er Jahre haben uns mit der Gewissheit eingelullt, die Bösen seien endgültig besiegt und das Motto Never more! sei unsere ewige Lebensweisheit.
In meiner Jugend, in den 1980er Jahren, erschien in der Flut der damals endlosen sowjetischen Kriegsfilme, die plakativ und verlogen waren, ein bemerkenswerter Film des Regisseurs Elem Klimow, „Komm und sieh", der die Vergeltung für die Verbrechen der Nazis an der zivilen Bevölkerung von Belarusj zum Thema hatte. Der Titel, der Offenbarung des Johannes entnommen, wirkte auf mich fast hypnotisierend. Jetzt aber schaue ich mir keinen Film an, sondern Bilder, die real sind. Der Fliegende Arm zwingt mich hinzuschauen. Die Bilder aus Butscha sind erst der Anfang, bald kommen Bilder aus Irpinj, aus Isjum, aus Mariupol, aus anderen ukrainischen Orten, die unter russischer Besatzung waren oder noch sind. Man darf die Augen nicht abwenden, man muss hinschauen, die unnatürlich verrenkten toten Körper der Menschen - eine Russin meinte im TV, die Bilder seien gestellt und künstlich, weil die toten Körper zu „unnatürlich" auf den Straßen von Butscha lägen!! - betrachten und sich wieder und wieder fragen: So sieht also das Böse im 21. Jahrhundert aus? Seine Grausamkeit kennt keine Grenzen und wenn man es nicht stoppt, wird man dieses grenzenlose Grauen bald in noch größerem unvorstellbaren Ausmaß sehen.

Es sind über dreißig Jahre vergangen, seit Juri Andruchowytsch, unser Dichter Nr. 1 zu Beginn der ukrainischen Souveränität, ein Gedicht geschrieben hat, dessen Handlung er entsprechend seiner damaligen Vorliebe für barocke Lyrik ungefähr in das 17. Jh. übertrug. Als Motto für sein Gedicht Das Land der Kinder diente ihm ein Zitat aus den Reisenotizen Paulus' aus Aleppo (!) (dessen osmanischer Name Būlus ibn Makāriūs al-Halabī war. Er lebte zwischen 1627 und 1669 und hat unter anderem eine wertvolle Beschreibung der Kosakenukraine zur Zeit ihrer Blüte hinterlassen): Jede Stadt und Kleinstadt im Kosakenland ist reich an Einwohnern, vor allem aber an kleinen Kindern. In jeder Stadt gibt es unzählige Kinder, sie alle können lesen, sogar die Waisenkinder. Dieses Land ist sehr reich an Witwen und Waisenkindern, ihre Männer und Väter wurden in endlosen Kriegen getötet. [...] Damals, vor über 30 Jahren, stellte das Gedicht ein Fragment der ukrainischen Geschichte dar, als sich die Standhaftigkeit der Ukrainer in dauernden Kriegen mit den Nachbarn abhärtete und als die Kinder sehr früh erwachsen und selbständig werden mussten.
Vor zwei Jahren, als der Krieg im Osten der Ukraine schon Jahre dauerte und jeden Tag menschliche Leben nahm, hat ein anderer ukrainischer Dichter, Serhij Zhadan, wohl unser Dichter Nr. 1 heute, ein Gedicht geschrieben, das er in Anspielung auf das seines älteren Kollegen Andruchowytsch genauso nannte: Das Land der Kinder. Zhadans Gedicht hatte das Drama der Kinder in den ostukrainischen Kriegsgebieten zum Thema, die in der besetzten Donbassregion unter unvorstellbaren Bedingungen der täglichen Lebensgefahr und Todesangst leben. Zhadans Gedicht traf den Nerv der Ereignisse, die von der Welt kaum zur Kenntnis genommen wurden. In einem Land mit so vielen Kindern weiß man, warum zu leben und wofür zu sterben: Zhadan drückte den klaren Gedanken aus, dass die Kinder, die in jedem Land die Zukunft dieses Landes bilden, beschützt werden müssen (meine Version des Gedichts füge ich diesem Text hinzu).
Wer hätte geahnt, dass im Jahr 2022 der Text an Aktualität gewinnen, dass das Leben der Kinder in der Ukraine noch stärker bedroht sein wird. Nach nur einem Monat Krieg sind in der Ukraine bereits so viele Kinder ums Leben gekommen, wie in acht Jahren Krieg in der Ostukraine.
Wenn man dieser Tage in Lwiw unterwegs ist, sieht man Dutzende Kinder um sich herum. Man bemerkt sie sofort, weil sie wie bunte Flecken in der eher grauen Stadtlandschaft sind, weil sie sich langsamer als Erwachsene bewegen, die sie mit kindlicher Zuversicht an der Hand halten, weil sie ungewöhnlich still sind ...
Im Pulverturm, wo die Tarnnetze hergestellt werden, befinden sich selten Kinder, aber manchmal kommt die eine oder andere Frau mit ihrem Kind, von dem sie sich nach den erlebten Schrecken auch nur für ein paar Stunden nicht mehr trennen will. Vor einigen Tagen war eines in unserem Stockwerk, wo Stoffe für die Netze geschnitten werden. Das Kind saß in einer überlangen grünen flauschigen Fleecejacke mäuschenstill in einer Ecke, beobachtete die Anwesenden ernst, flüsterte seiner Mutter ab und zu etwas zu. Ich wunderte mich, dass der Bub das Sitzen und Warten so geduldig ertrug, traute mich aber nicht, ihn anzusprechen. Neben mir saß, wie oft, ein geschwätziger älterer Herr, der, ehrlich gesagt, zumeist eine Nervensäge ist, aber an dem Tag plötzlich seine gute Seite zeigte. Er sprach den etwa 6-jährigen Buben an, lobte ihn, dass er seiner Mama half, lächelte ihm zu, und das Kind verwandelte sich, wie sich Knospen in Blätter oder Blüten verwandeln: Es wurde immer gesprächiger, antwortete auf die Fragen des Alten immer lustiger, mit immer lauterer Stimme, verließ dann seinen Sitzplatz und benahm sich endlich, wie sich normalerweise alle Kinder benehmen: Der Bub rannte zwischen den Stühlen und Stoffen umher, brummte und war mal ein Wagen, dann ein Personenzug, dann ein Vogel. Er war über die Freundlichkeit ihm gegenüber so erleichtert, glücklich und dankbar, er rannte und zwitscherte, rannte und beobachtete, wie die anderen auf ihn reagierten. Ich verfolgte seine steigende Lebendigkeit und musste mitlachen und als er mein Lachen sah, rannte er auf mich zu und umarmte mich aus aller Kraft, sein kleines Herz pochte vor Freude: Er konnte wieder er sein, er musste nicht still und unbemerkt hocken, er verstand, dass es hier Leben gibt, dass die Menschen hier seine Freunde sind... Ein glückliches flauschig-grünes Kind. Damian.
Ein Flugzeug hat er in seinem Spiel übrigens nicht dargestellt.
Das Gedicht Das Land der Kinder von Serhij Zhadan in deutscher Nachdichtung:
Das Land der Kinder
So viel Kummer, so viele Nöte
du kannst keinen Schritt machen,
du hältst das Herz an und zählst die Verluste.
Am meisten fehlt es an guten Nachrichten.
In einem Land mit so vielen Kindern weiß man,
warum zu leben und wofür zu sterben.
Der Vogelkäfig ist viel zu eng
und leichtfüßig kommt jeder Lenz,
die Zeit reißt ab mit Echobrandung.
Von uns bleiben Freude und Lachen.
Lieben - heißt für alle da sein.
Glauben - heißt andere führen können.
Es brennen, brennen Brücken, es wachsen Wände,
aber Kinder, die wachsen in den Himmel des Landes,
Kinder, die setzen unsere Sprache fort,
die halten für uns oben das Himmelsgewölbe.
Das Land war nie böswillig.
Das Land war schon immer hier.
Das Land, wohin der Regen zurückkehrt,
über das sich Gedichte so leicht schreiben.
Das Land, das größer als alles Böse ist.
Es lieben für alles, was früher war.
Es lieben für jeden Sonnenaufgang.
Ich hätte noch Fragen.
Was lässt uns hier nicht los?
Wir sind so wenige auf dem Planeten.
Die Sterne leuchten uns so wohlwollend.
Da kommen die Kinder vom Fluss zurück.
Da kommen die Kinder wieder heim.
Wir sind die, die hier weiter leben, wir.
Das Haus füllt sich mit Gästen und Stimmen.
Das Land der Kinder atmet ruhig und still.
 Und hier der Link auf das Lied zu diesem Gedicht, das letzten Sommer entstand>>
Und hier der Link auf das Lied zu diesem Gedicht, das letzten Sommer entstand>>

Schnipp-schnapp - schnipp-schnapp - schnipp-schnapp - - -
Wie gut mir die Eintönigkeit und Wachsamkeit dieses kalten Geräusches tut.
Ich schneide, schneide konzentriert und sorgfältig, schneide wie besessen, schneide voller Liebe zu denen, die meine Arbeit beschützen soll, schneide voller Hass zu denen, die unser Leben auslöschen wollen, schneide und beruhige mich, verfalle in eine Art Meditieren.
Die Materialität des Stoffes, den ich in gleichmäßige Streifen schneide, lässt mich daran denken, dass der Krieg real ist. Meine Aufgabe hier, im mittelalterlichen Pulverturm meiner Stadt Lwiw, ist, Berge von Kleidern, Bettwäsche und Tuchballen zu zerschneiden. Stoffschnipsel werden von jungen fröhlichen Student*innen der Lemberger Kunstakademie in große Netze eingeflochten, so werden Tarnnetze hergestellt. Tarnnetze sind Kunstwerke der Kriegszeit. Riesige Netze, die aus Hunderten, Tausenden schwarzen, grünen, braunen, grauen, dunkelblauen Stofffetzen hergestellt werden, bilden die beschützenden Engelsflügel, die die Geschoße abwenden sollen. Die Verwandlung alltäglicher Stoffstücke in riesige Stoffbahnen, die Entfremdung vom ursprünglichen Gebrauchszweck geschieht im Laufe des Tages durch die Bemühungen mehrerer Freiwilligen. Tarnung ist gleich Schutz. Schutz vor kriminellen, das Land terrorisierenden hauptsächlich jungen Männern mit russischen Pässen. In Gefangenschaft genommen, bereuen diese Männer in die Kamera ihre Taten, versichern, von nichts „wirklich" gewusst zu haben, versprechen, nie mehr wieder jeweils das zu tun ... Ihre Versicherungen sind auch Tarnung. Ich glaube nicht, dass jemand, der in einem Panzer über Getreidefelder in einem fremden Land fährt und den Boden für Jahrzehnte für jede Ernte unbrauchbar macht, keinen Krieg im Kopf hat. Ich glaube nicht, dass jemand, der ein Ziel im Visier hat, in der Satellitenbilder-Ära nicht weiß, dass da Wohnungen von friedlichen Menschen getroffen werden, dass der Beschuss viele Hunderte Menschen ohne Bett und ohne Dach über dem Kopf lässt. Ich glaube nicht, dass jemand, der ein Entbindungskrankenhaus unter dem Vorwand bombardiert, darin seien in Wirklichkeit nicht Frauen, sondern ukrainisches Militär, nicht weiß, dass dort doch vor allem Frauen und Neugeborene sind. Sowie medizinisches Personal. Dort sind Frauen, deren größtes Unglück in diesen Wochen ihre Mutterschaft ist. Immer wieder steht vor meinen Augen das Bild einer blutenden hochschwangeren bildhübschen Frau. Sie schaut mit vor Verzweiflung blinden Augen in die Kamera, eine Madonna des Jahres 2022. An ihr vorbei wird eine andere schwangere Frau getragen, eine der vielen, die diesen Schock, dieses Entsetzen nicht überleben wird, weder sie, noch ihr ungeborenes Kind.
RRRATSCH - RRATSCH - RATSCH
Ich reiße den Stoff, ich versuche meine steigende und zugleich lähmende Aggressivität in das Reißen der Stoffe zu leiten, ich zerreiße mit lautem Geräusch den Stoff eines Lakens in meinen Händen. Niemand wird auf diesem Laken mehr schlafen, es wird niemands Bett mehr bedecken, aber ich will sehr, dass es unsere Beschützer bedecken wird, dass sie zu keinem Schießziel werden, dass sie überleben, in die unzerstörten Häuser, zu ihren Familien möglichst bald zurückkehren, wo alle überleben sollen, so sehr will ich das. Aber vorher muss man die dunkle Tsunami-Welle des Bösen abwenden. Denn im anderen Fall (habe ich wirklich „anderer Fall" geschrieben? Nein, ich darf einen „anderen Fall" nicht einmal annehmen! In allen Märchen meiner Kindheit wurde das Böse unbedingt besiegt. Die Gerechtigkeit muss siegen, weil es sich anders nicht lohnt, in dieser Welt weiterzuleben.) bleibt auf diesem riesigen und doch so kleinen, so innig geliebten Stück Planet nur verbrannte Erde.
Ich halte mit einem Ruck inne. Es wird mir dunkel vor den Augen. Hunderte Bilder, die ich in den 25 Tagen bereits sah, helfen mir in meiner Phantasie. Ich sehe eine weite, weite Gegend, wo die Erde schwarz ist, aber es ist nicht die berühmte ukrainische Schwarzerde, es ist eben diese verbrannte Erde, wo nichts wachsen kann, wo kein Baum steht und deshalb kein einziger Vogel singt, wo das Einzige, was sich bewegt, der aufsteigende schwarze Rauch ist. Mir wird schwindlig, Ich halte mich mit beiden Händen an einer schwarzen Jeans, die ich gerade zerschneiden will, ich versuche im Viereck zu atmen: Einatmen - Pause - Ausatmen - Pause. Einatmen - Pause - Ausatmen - Pause. Das Herz dröhnt in den Schläfen. Einatmen. Es gibt Menschen neben mir, meistens Frauen, sehr viele sind aus den Gebieten, wo aktive Kämpfe geführt werden. Einige haben nur das, was sie anhaben. Sie arbeiten ruhig und entschlossen. Ausatmen. Ich darf nicht hysterisch werden. So viele Menschen wollen zur Normalität zurück. In der Zeit der Revolution der Würde hatten wir einen Slogan, der mich jetzt nicht loslässt: Du bist ein Tropfen im Ozean. Einatmen. Ja, ich bin ein Tropfen. Und das bedeutet nicht, dass ich nichts bedeute. Im Gegenteil: das heißt, dass wir gemeinsam eine mächtige Kraft sind, die nie vom Bösen bewältigt werden kann. Dass wir zusammenhalten müssen. Die ganze Welt. Ausatmen.
Schnipp-schnapp - schnipp-schnapp - schnipp-schnapp ---------------------
© Chrystyna Nazarkewytsch