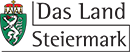Fragile Materialien
Die in Berlin lebende Künstlerin Nina Schuiki schafft mit einfachen Materialien Objekte und Rauminstallationen, die berühren. Im Frühjahr 2024 war sie mit einem Atelier-Auslandsstipendium des Landes Steiermark als Artist in Residence am Brüsseler Kunstzentrum WIELS. Ein Interview mit der international aktiven Künstlerin.
Sie ließ Tränen luftdicht in zarte Glaskugeln einschließen, arbeitet gerne mit Wachs und zerbrochenem Sicherheitsglas und neuerdings mit Pflanzen. Mit ihrem Vorschlag, einen Riss in das Granitpflaster vor dem Museum der bildenden Künste in Leipzig zu ziehen und diesen mit Weidenröschen zu bepflanzen, konnte sich Nina Schuiki 2023 bei einem offenen Gestaltungswettbewerb durchsetzen. Auch in Brüssel setzte die vielseitige Künstlerin, die die stillen Töne bevorzugt, eine Arbeit mit Pflanzen um. Viele von Schuikis Werken sind wie Gedichte: Man erfasst eine Bedeutung, die durch Formen und Materialien angeregt wird, möchte sie aber gar nicht ganz auflösen, weil man will, dass es in einem weiterarbeitet ... Das Interview mit der Künstlerin wurde Mitte Juni während ihres Aufenthalts am Brüsseler WIELS über Zoom geführt.
In vielen deiner Arbeiten kommen Bruchstellen vor, z. B. bei den aus Wachsresten zusammengefügten Kerzen oder bei deinen Installationen mit zerbrochenem Sicherheitsglas. Was fasziniert dich an den Brüchen in der Welt, die du sichtbar machst?
Das ist eine schöne Frage. Einerseits tragen die Materialien, die ich in meinen Arbeiten verwende, allesamt Potenzial zur Veränderung in sich. Sie können sich verändern oder sich auflösen und verschwinden. Es fasziniert mich, ein Kunstwerk zu machen, das im Prozess ist. Mir ist es wichtig, dass die Arbeit nicht aufhört, wenn man sie ausstellt, wie das im klassischen Sinn passiert, sondern dass sie mit ihrer Umwelt zu arbeiten beginnt. Was in Bewegung ist, hat immer Potenzial zur Veränderung - oder Potenzial, etwas zu öffnen. Ich würde das, was du Brüche genannt hast, auch als Zwischenräume oder Möglichkeitsräume bezeichnen, wo etwas passiert. Bei meinen neuen Arbeiten mit den Pflanzen ist das Prozesshafte natürlich extrem. Ich würde sagen, dass Pflanzen mein fragilstes Material bisher sind. Mitte Juni war die Eröffnung der Arbeit in Leipzig, wo aus einem Riss Pflanzen wachsen. Ich mache aber auch gerade in Brüssel eine Arbeit mit Pflanzen.
Welche Pflanzenarbeit setzt du in Brüssel um?
Da muss ich ein bisschen ausholen: In Brüssel interessiert mich die Stadt an sich, die urbanen Prozesse, die hier schneller ablaufen als in Graz oder auch in Wien. In Brüssel wird sehr viel gebaut, gleichzeitig passieren gesellschaftliche Umbrüche. Ich bin bei meinen Residencys immer viel im Stadtraum unterwegs. Das Erste, was ich mache, ist meistens, ein Fahrrad organisieren, mit dem ich herumfahre, damit ich ein Gefühl bekomme für die Stadt. Dabei habe ich Fragen im Hinterkopf wie: Womit könnte ich arbeiten, und welche aktuellen Diskurse gibt es vor Ort? In Brüssel sind mir recht schnell städtische Brachen und Leerstände aufgefallen - als Flächen, die absichtlich leer gehalten werden, weil damit spekuliert wird. Ich habe einen Ort gefunden, der aus einer großen Parkanlage besteht, und rundherum befinden sich luxuriöse Neubauten. In dieser Parkanlage gibt es hinter einer Baumgruppe eine Fläche, die wild geblieben ist. Ich war davon fasziniert und habe mich gefragt, warum da nichts gebaut ist und warum die Fläche nicht gepflegt ist - und damit habe ich ein sehr großes Fass aufgemacht. Dieser Ort war einmal ein Güterbahnhof und danach eine Brachfläche, wo die Bewohner*innen lange Zeit mit eigenen Gärten sehr involviert waren - bis das Areal verkauft wurde. Es ist ein aufgeladener Ort, von dem diese Restfläche übriggeblieben ist, auf der auch einige Wildpflanzen überdauert haben. Ich bin während meines Aufenthalts immer wieder hingegangen und habe dokumentiert, welche Pflanzen gerade aufgegangen sind. Da dort zuvor ein Frachtbahnhof mit Anbindung an das Meer war, sind vermutlich auch beiläufig Pflanzensamen von anderen Ländern dort angekommen. Man könnte sogar annehmen, Details der Geschichte Belgiens als Kolonialmacht dort wieder zu finden. Am Schluss meiner Residency werde ich eine Installation machen, indem ich eine Pflanze dorthin bringe und sie in einem Kreis pflanzen werde.
Welche Pflanze hast du dafür ausgesucht?
Das ist die Achillea ptarmica, die Sumpfschafgarbe. Das soll einerseits einen Bezug zu Brüssel herstellen, denn die Stadt wurde in einem sumpfigen Gebiet errichtet, und noch heute kommt in vielen Baugruben das Wasser von alleine schnell hoch. Und andererseits leitet sich der Gattungsname Achillea von der antiken Figur Achilles ab, der in der Heilkunde unterrichtet war. Das verweist somit auf die mythologische Bedeutung der Pflanze: Mit der Achillea wurden Wunden behandelt. Da spielt auch der Gedanke an diesen Platz als Wunde mit.
Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich etwas in der „Natur" mache, auch wenn diese Natur vom Menschen gemacht oder beeinflusst ist. Bisher habe ich natürliche Prozesse in städtische, architektonische Situationen gebracht. Jetzt ist es das erste Mal umgekehrt.
In deiner Bewerbung für WIELS hast du ein Projekt mit Photogrammen vorgeschlagen, denn du arbeitest auch mit Lichtspuren auf Wachs. Auch etwas sehr Vergängliches. Hast du das weiterverfolgt?
Das habe ich tatsächlich weiterverfolgt als Atelierpraxis in Brüssel. Ich habe eine neue Technik entwickelt, bei der ich Wachs auf Leinwände auftrage - und das in unzähligen feinen Schichten, um zum Schluss eine spezifische Oberflächenbeschaffenheit zu haben. Diese Wachsplatten sind jetzt fertig, und ich werde sie Ende Juni in der Stadt aussetzen und belichten. Das Wachs ist an sich lichtempfindlich, es reagiert auf UV-Strahlen und färbt sich zart gelblich, wenn es Sonnenlicht ausgesetzt ist. Mir ist das zufällig aufgefallen. Ich hatte eine Installation mit Wachsobjekten, und beim Abbau habe ich bemerkt, dass eine Seite der Objekte sich verändert hatte.


2019 warst du Artist in Residence in Jerusalem, 2022 in New York. Davor warst du unter anderem in Shanghai. Was bringen Auslandaufenthalte für dich und deine Arbeit?
Auslandsaufenthalte liefern enorm wichtige Inputs für meine Produktion. Wenn ich nur am Schreibtisch in Berlin sitze, kommen mir wenig Ideen. In einer anderen Stadt neue Arbeiten zu konzipieren und neue Inputs zu erhalten, gibt mir wahnsinnige Freiheiten. Auch der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ist sehr wichtig. In meiner Praxis sind Residencys existenziell. Ich überlege auch immer sehr genau, wo ich hingehen will und suche mir da Aspekte, die mich interessieren.
Bei deiner New Yorker Residency hast du mit gebrauchtem Wachs gearbeitet, das du über eine Web-Plattform gesucht hast. Dadurch hast du Leute kennengelernt. Wie wichtig sind dir Begegnungen mit den Bewohnern einer Stadt im Rahmen deiner Residencys?
Sehr wichtig. Ich habe oft im Zuge meiner Arbeiten ganz viele Begegnungen, die sich später in den Installationen oft nicht direkt erkennen lassen. In New York war das Wachssammeln eine Strategie, und ich habe mich oft mit Leuten verabredet, die mir Wachs zur Verfügung gestellt haben. Dadurch bin ich immer irgendwo hingekommen, wo man sonst nicht hinfahren würde. Ich habe auch erfahren, zu welchem Anlass die Kerzen angezündet worden waren. Ich habe diese Geschichten in mein Archiv aufgenommen, habe sie aber zum Schluss in der Arbeit wieder abstrahiert.
Du hast in Berlin am Institut für Raumexperimente bei Ólafur Eliasson studiert, einem dänisch-isländischen Künstler. Dein Professor sagt auf seiner Website, er wolle mit seinen Arbeiten „Körper- und Sinneserfahrungen anstoßen, die zu Einsichten führen". Welches Ziel verfolgst du mit deinen Arbeiten?
Für mich persönlich dienen meine Kunstwerke dazu, einen Dialog mit der Welt und meiner Umgebung herzustellen. In meiner Arbeit verwende ich oft ganz persönliche Details und Emotionen, die ich aber verschlüssle. Das ist so, wie wenn man ein gutes Gedicht liest, das auch persönlich ist, aber das Persönliche ist abstrahiert, und man kann daran anknüpfen. Mich berührt es, wenn andere Leute berührt sind von meinen Arbeiten und wenn sie ihre Aufmerksamkeit dadurch schärfen.
Wie „liest" du Räume, wenn du wo reingehst?
Jedes Mal, wenn ich für eine Ausstellung in einen Raum gehe, finde ich es zuerst unfassbar schwierig. Ich versuche aber, die nicht sichtbaren Kontexte, die historischen oder architekturgeschichtlichen Zusammenhänge mit meinen Recherchen zu erfassen. Dadurch ergeben sich viele Schichten und Verbindungen.
Wie hast du zum Beispiel das Grazer Forum Stadtpark „gelesen", wo du 2022 die Scheiben besprüht und dadurch wie gesprungenes Glas hast aussehen lassen?
Das war sehr intuitiv. Das Erste, was einem auffällt, wenn man im Forum Stadtpark steht, ist eigentlich, dass man fast im Park steht. Durch die großen Verglasungen gibt es einen starken Bezug zum Außen. Da habe ich sofort gewusst, die Arbeit muss etwas mit dem Blick nach außen zu tun haben, und dann habe ich bald gewusst, es soll so ausschauen, als wäre das Glas zerbrochen oder eingeschlagen. Es hat aber seine Zeit gebraucht, es im Detail zu entwickeln. Im Kontext mit der Pandemie hat die Arbeit dann noch einmal einen anderen Aspekt gewonnen, weil sich während dieser Zeit auch das Verhältnis zwischen dem Außen und dem Innen verschoben hat.



In anderen Arbeiten verwendest du zerbrochenes Sicherheitsglas, das du im Raum anordnest. Wo bekommst du, ganz pragmatisch gefragt, das Material her?
(Lacht) Am besten in Berlin am 1.1. - da gibt es Reste von der Silvesternacht. Angefangen hat es mit zerstörten Bushaltestellen, wo das gesprungene Glas in Haufen gelegen ist. Ich habe das mitgenommen, und irgendwann ist es ein Selbstläufer geworden, und Freunde haben mich immer informiert, wenn irgendwo Glas gelegen ist.
Du bist 2012 von Wien nach Berlin gezogen. Wie ist es, in Berlin zu leben - im Unterschied zu Wien oder zu Brüssel?
Der Unterschied zu Wien und Brüssel ist, dass Berlin größer ist, und dass es nicht ein Zentrum gibt, sondern mehrere Zentren; und auch in der Kunstszene gibt es nicht eine Bubble, sondern viele verschiedene. Das würde ich mal als größten Unterschied sehen. Und von meiner Perspektive aus: Natürlich jammert in der Stadt jeder gerne, aber wenn man hier studiert hat und sich sein Netzwerk aufgebaut hat, ist Berlin ein gutes Pflaster, um hier zu leben und zu arbeiten.
Biographische Notiz
Nina Schuiki ist 1983 in Graz geboren. Sie besuchte von 2009 bis 2012 die „Klasse für Fotografie" an der Universität für Angewandte Kunst in Wien und ging 2012 nach Berlin, wo sie am Institut für Raumexperimente an der Universität der Künste Berlin studierte. 2014 schloss sie das Studium als Meisterschülerin ab. Nina Schuikis Arbeiten waren u. a. bereits in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Großbritannien, den USA und Südafrika zu sehen. Sie war als Artist in Residence unter anderem in Jerusalem (Atelier-Auslandsstipendium des Landes Steiermark 2019), New York und Shanghai.
Website:  http://www.ninaschuiki.org/
http://www.ninaschuiki.org/
Interview: Werner Schandor
Juni 2024