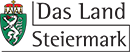Einblicke in die Randperspektive
Ein Gespräch mit Ferdinand Schmalz über Verweil-Orte, Nicht-Orte und Privatphilosophien.
Wir treffen einander vor dem Wiener Volksgartencafé. Leider hat dieses geschlossen: Es könnte Regen kommen. Also wandern wir durch den über und über mit blühenden Rosen bewachsenen Volksgarten bis zum Café Landtmann. Dort findet sich ein Platz zum Sitzen und für ein anregendes Gespräch mit Ferdinand Schmalz, dem Peter-Rosegger-Literaturpreisträger des Landes Steiermark 2020.
Einer Ihrer vielen Preise. Was bedeutet er für Sie?
Spannend, wenn man dort, wo man herkommt, ausgezeichnet wird. Das bedeutet mehr. Ich habe künstlerisch in Deutschland schnell Fuß gefasst. Der Preis ist auch ein bisschen wie daheim ankommen.
Es muss sein: Schweiger oder Schmalz?
Schmalz war mein Spitzname in der Schule. Ein Freund hat mich als Walross karikiert und mit „Schmalz“ signiert. Das ist dann hängen geblieben. Ferdinand ist später dazu gekommen, als Spiel mit Autorenidentität. In meinen ersten Publikationen habe ich auch „Erfundenes“ in die Lebensläufe geschrieben. Ich wollte die Vorstellung, wer hinter dem Text steht, destabilisieren.
Sie sind Theaterwissenschaftler, Dramaturg, Performer. Wann und wie ist das Schreiben dazugekommen? Was hat Sie ermutigt, selbst künstlerisch zu arbeiten?
Ich war zunächst Regieassistent, habe aber bald bemerkt, dass mir das gar nicht liegt: Viel zu fad und die Probenarbeit sehr beschwerlich ... immer den Schauspielern Anweisungen geben. Ich habe mich viel lieber mit Texten beschäftigt. Wir haben die Performancegruppe „Mulde 17“ gegründet und ein Nilpferd gebaut, dessen Bauch wir mit Texten von mir bespielt haben. Man konnte durchkriechen. Aus den überschüssigen Texten sind Stücke entstanden. Damals habe ich bemerkt, dass Tüfteln am Schreibtisch, Spracharbeit „meines“ ist. Theaterstücke schreiben sich schneller, dann überarbeite ich sie. Ein Roman braucht mehr Disziplin, auch Rückzug.
Begonnen aber hat alles in Admont, wo ich ins Stiftsgymnasium gegangen bin. Dort gab es zwei Schülerselbstmorde. Eine engagierte Lehrerin hat bemerkt, dass unsere Theaterarbeit ein gutes Ventil für die Verarbeitung dieser traumatischen Vorfälle ist. Wir haben uns getroffen, viel geprobt und sind im Anschluss mit „Frühlingserwachen“ von Frank Wedekind auf Tour durch steirische Schulen gegangen.
Mein Vater hätte gern gehabt, dass ich seine Arztpraxis übernehme. Erst nach der ersten Premiere im Schauspielhaus Wien, wo ich als Conférencier gewirkt habe und angestellt war, haben die Eltern gesehen, dass es Ernst ist.
Etwas ganz anderes: Wo schreiben Sie, wie kann mach sich das vorstellen? Gibt es einen bestimmten Prozess?
Das läuft immer ganz gleich ab. Erstens: Theorie - lesen, überlegen, Input holen (Bilder und Fotos an den Wänden). Zweitens: Schreibphase - intensiv und schnell. Drittens: Überarbeiten - laut lesen, rhythmisieren. Früher war ich viel in Bibliotheken, wenn ich gearbeitet habe. Das mache ich nicht mehr, weil die Professoren und Studenten immer mit mir sprechen wollten. Das stört den Fluss. Deshalb habe ich jetzt eine Schreibkammer im 17. Bezirk.
Corona. Wie ist es Ihnen in der Zeit des Lockdown gegangen? Wo haben Sie sich aufgehalten? Und sind diese Monate nicht geradezu aufgelegt, ein Stück darüber zu schreiben? Über die Menschen, ihre Ängste, das Absurde und Reglementierte?
Das Herausgerissen-Sein war gut. Man muss die Katastrophe annehmen, sich zurücknehmen dürfen. Viele KünstlerInnen haben produziert. Ich wollte mich rausnehmen, das Erlebte sacken lassen. Vielleicht gibt es in einem Jahr einen Text, der reflektiert, was durch Corona passiert ist. Ich frage mich derzeit: Was bedeutet diese Zäsur für die eigene Arbeit? In Admont, wo meine Eltern leben, war ich im Wald, im Garten, habe gelesen, mir Input geholt. Z. B. Miranda July: Der erste fiese Typ. Ein tolles Romandebüt.
Ihre Stücke spielen überall, wo Menschen sich versammeln oder eben zufällig aufeinandertreffen. Wir (LeserInnen, Publikum) alle finden uns in Ihren Figuren wieder. „Sie identifizieren sich zu sehr mit ihren Symptomen“, sagt Herr Moser zu Herrn Maier im Stück „der thermale widerstand“. Nehmen wir uns zu wichtig? Was genau kritisiert Herr Moser, wenn er Herrn Maier unbarmherzig rügt?
Viel von der Sprache kommt von den Settings, die ich suche. Research is everything. Man muss sich dem Milieu aussetzen, über das man schreibt. Ich liebe diese Orte, diese Verweil-Orte, Nicht-Orte, in denen das Leben seine Bahnen zieht. Theorien von Philosophen werden hier auf „Butter“ oder „Kurpark“ heruntergebrochen. Man taucht ein in schiefe Privatphilosophien, mit viel Humor und Erkenntniswert. Ein theoretischer Ton trifft auf Alltagssprache von Randfiguren. Es ist die Sprache einer Randperspektive. Ich spreche daher lieber von „Randstücktradition“ als von „Volksstücktradition“.
„der thermale widerstand“ ist mein Lieblingsstück. Ich war zweimal auf Kur und habe erlebt, was Sie beschreiben: diese ungeheure Konzentration auf die eigene Kleinstwelt mit ihren teils lächerlichen Ausprägungen. Was interessiert sie am Lächerlichen, am Kleingeistigen?
Lächerlichkeit ist nicht mein Wort. Ich präsentiere Figuren, versuche aber, mit jeder Figur etwas verständlich zu machen, ihre Nöte darzustellen. Ich nehme alle Figuren sehr ernst. Lächerlich sind sie vielleicht nur auf den ersten Blick. Über das Stück hinweg kommt man den Figuren nahe, etwas Liebenswertes entsteht. Komödie ist ein Drahtseilakt zwischen Lächerlichkeit und den existentiellen Nöten einer Figur. Es ist die Engstirnigkeit, die in vielen Bereichen herrscht, das ewige Brett vor dem Kopf, das ich beobachte. Wenn diese kleine Welt bedroht ist, kann man nicht erkennen, dass man nur einen Schritt weitergehen müsste, um „die Welt zu retten“. Das ist die Engstirnigkeit der „dörflichen Enge“; dort wo die Täler eng werden, wird's eng ... Lebensweise, Sprache und Landschaft sind sehr anziehend. Aber nach zwei bis drei Wochen wird es so eng, dass ich flüchten muss. Schade, dass es nicht mehr Kulturprojekte auf dem Land gibt, wie das „Kulturviech Rottenmann“, das von Hannes Pointner in die Welt gerufen wurde. Er hatte es sehr schwer, unglaublich viel Gegenwind von der Regionalpolitik. Das, obwohl er die Menschen vor Ort integriert hat. Beispielsweise habe ich mit ihm „Biedermann und die Brandstifter“ mit der örtlichen Feuerwehr gemacht.
Sprechen wir von der oft zitierten Theaterkantine? Ein Sehnsuchtsort für Sie? Welche wäre denn die ideale?
Die Burgtheaterkantine mag ich sehr gerne. Ich sage ja immer, Dramatiker ist nur eine Station auf meinem Weg zum großen Ziel, einmal eine Theaterkantine zu übernehmen. Als Student war ich Komparse. So auch Ritter mit Lanze in Luc Bondys „König Lear“. Das Stück wurde unter Verwendung unglaublicher Ressourcen aufgeführt. Es gab zwei bis drei Reiter, Pferde in Koppeln. Die Pferde sollten auftreten. Dann kam die Ansage „Pferde im Aufzug“. Das mochten sie gar nicht an der berühmten Theaterluft. Bald waren sie zurück auf ihren Koppeln. Ein Mikrodrama. Dafür war Gert Voss bereits in der Früh ein alter, verwirrter König.
Noch ein paar Heimatfragen: Wir Steirer sagen, Sie sind ein steirischer Künstler. Mögen Sie das? Was ist die Steiermark für Sie? Welchen Heimatbegriff haben Sie?
Wenn man ein bisschen Erfolg hat, wird man sofort als Steirer, Wiener, Admonter oder Alsergrunder apostrophiert. Das Kommen aus der Steiermark ist sicher prägend. Mein Heimatbegriff ist ein ambivalenter. Mit der Heimat ist es wie mit der Familie, man hält es nicht mit ihr aus, aber auch nicht ohne sie. Das hat Vor- und Nachteile; man freut sich und leidet auch.
Das Land Steiermark hat vor, ab 2021 jährlich zwei Arbeitsstipendien für NachwuchsautorInnen einzurichten. Diese bekommen Geld und einen renommierten Lektor als Mentor für ein literarisches Projekt. Kann diese Maßnahme aus Ihrer Sicht sinnvoll sein?
Auf jeden Fall. Ich bemerke, wie toll es ist, in welchem Umfang hierzulande AutorInnen gefördert werden. In vielen Ländern gibt es keine Förderung, wenn man die ersten Schritte setzt. Mentoring ist auch deshalb so hilfreich, weil man einen Eindruck davon bekommt, wie der Literaturbetrieb funktioniert. Dann kann Sicherheit entstehen. Gerade am Anfang ist es schwierig, gute LeserInnen zu bekommen, denen man vertrauen kann, die Feedback geben und so mehr Gefühl für das eigene Werk vermitteln. Josef Winkler war mein Mentor. Er hat mir dabei geholfen, die Sprache anders zu betrachten, verschütteten Bedeutungen auf den Grund zu gehen ... in welche Tiefen man gehen kann.
Wenn man an steirische AutorInnen denkt, was muss man unbedingt gelesen haben?
„Der Pfirsichtöter“ von Alfred Kolleritsch und „Tram 83“ von Fiston Mwanza Mujila fallen mir da spontan ein.
Worauf dürfen sich die LeserInnen als Nächstes freuen, woran arbeiten Sie, und kann man Ihre Werke bereits in anderen Sprachen lesen?
Ich schreibe an einem Roman, der bei Fischer verlegt wird. Er wächst und wächst, wird 2021 erscheinen. Mein Text „mein lieblingstier heißt winter“, mit dem ich den Bachmann-Wettbewerb gewonnen habe, ist die Basis dafür. Es geht um einen Tiefkühlwarenvertreter auf der Suche nach einer Leiche. Der Roman ist an den Rändern der Stadt angesiedelt. Es macht Spaß, Prosa zu schreiben. Man kann es beim Schreiben laufen lassen, die LeserInnen gehen mit, kann den Verzweigungen der Fiktion nachgehen. Ich versuche, die Aufmerksamkeit der LeserInnen, hinsichtlich Spannung und Figurenkonstellation mitzudenken. Übersetzungen meiner Stücke gibt es bereits in mehrere Sprachen: Englisch, Slowakisch, Polnisch fallen mir da ein.
Kurzbio Ferdinand Schmalz
Geboren 1985 als Mattias Schweiger in Graz. Aufgewachsen in Admont. Studium der Theaterwissenschaften und Philosophie in Wien. Lebt als Autor in Wien. 2013 Retzhofer Dramapreis, 2014 Einladung zu den Mühlheimer-Theatertagen, 2017 Ingeborg-Bachmann-Preis, 2018 Ludwig-Mühlheims-Theaterpreis, 2018 Nestroy Theaterpreis.
Interview aus der Publikation zu den
steirischen Landes-Kunst- und -Kulturpreisen 2020