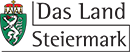Von Knöpfen, Museen und starken Frauen
Ulrike Vonbank-Schedler, Trägerin des Hanns-Koren-Kulturpreises 2021, im Gespräch
Hoch er dem Murtal lebt Ulrike Vonbank-Schedler mit ihrem Mann Walter, dem Orgelbauer, und ihrer Hündin Berta. Die gelernte Damenschneiderin, die in mehreren Vorarlberger Textilbetrieben praktiziert hat, hat von da oben den Überblick. Aus einer Hörbranzer Arbeiterfamilie stammend, wurde sie in die Textilschule in Dornbirn geschickt, nicht etwa in die HTL für Maschinenbau, wie sie es selbst gerne gehabt hätte. Später, in Wien, studierte sie an der Akademie der bildenden Künste. Textiles Gestalten, Lehramt wurde von ihr erwartet. Die erste Akademikerin in der Familie gab nach dem Probejahr auf. Schule mochte sie nie, auch nicht als Lehrende.
So fand sie sich schließlich mit Kindern, Mann und Betrieb in Wien wieder. Die Werkstatt war bald zu klein und der Kinderspielplatz keine Option. Es sollte also aufs Land gehen. Das Umland von Wien war zu teuer, und bald begannen die Vonbanks die Steiermark zu erforschen. Über einen Künstlerfreund kamen sie zum ersten Symposium in Schrattenberg, das Heimo Wallner veranstaltet hatte. Die Gegend fühlte sich vertraut an, angenehm, und auch einen Ort für Kunst und Diskussion in der Nähe zu haben, waren Motivation genug, sich im oberen Murtal anzusiedeln.
Was hält Sie in Murau? Was macht der Ort für Sie aus, dass Sie ihn als Lebensmittelpunkt gewählt haben?
Uli Vonbank-Schedler: Wir suchten einen Ort zum Leben und Arbeiten, aber auch für Kunst, Diskussion und Beteiligung. Das haben wir gefunden. In dieser Gegend, die etwas vom hinteren Bregenzerwald hat, vom Vorarlberg der 70er. Weit genug weg von Nachbarn, aber nah genug, um miteinander etwas auf die Beine zu stellen.
Haben Sie das Gefühl, das Profil des Hanns-Koren-Kulturpreises passt zu Ihnen, dass es der richtige Preis für Sie ist?
Ich kannte den Preis nicht. Dann hab' ich ihn gegoogelt, auch Hanns Koren gegoogelt. Ich hätte mich nicht nominiert, weil es präsentere Menschen gibt, die im Kulturbereich tätig sind. Der Preis hat mich dazu gebracht, meine Tätigkeit zu reflektieren. Meine Arbeit hat schon etwas gebracht für das kulturelle Selbstverständnis der Region, ihrer Menschen. Die Person Koren fasziniert mich; was er als konservativer Politiker gefördert und zugelassen hat. Das sehe ich heute in der Politik nicht. Die Auseinandersetzung als fruchtbarer Boden wird nicht gepflegt. Leider auch nicht in der Kommunalpolitik.
Nun wissen wir, dass mit der Charakterisierung des Preisprofils genau Sie gemeint sind. Was ist es denn, was Ihnen derzeit besonders am Herzen liegt? Ist Kulturarbeit auf dem Land schwieriger als in der Stadt? Wie haben Sie damit begonnen?
Besonders am Herzen liegt mir das Interagieren mit Menschen. Im ländlichen Raum glauben viele, dass sie mit Kultur nichts am Hut haben. Sie verstehen nicht, dass sie Teil der Kultur sind: was sie tun, was sie essen, was sie anziehen. Das alles macht Kultur aus. Ich habe ein „Oral History"-Projekt entwickelt, damit sich die Teilnehmerinnen udn Teilnehmer mit ihrem Tun auseinandersetzen, es selbst wertschätzen lernen. Das Mitwirken und „Im Kleinen Bewegen" sind es, was das Gesamte so anders macht.
Kulturarbeit auf dem Land finde ich nicht schwieriger, aber anders als im urbanen Bereich. Man wird viel schneller gesehen mit dem, was man tut. Man muss sich in Netzwerke begeben. Bei mir war der Anfang, indem ich meinem eigenen Fremdsein in der Region nachgegangen bin. Ich wollte mehr darüber wissen, wo ich bin, ich hab' mich darüber informiert, dass in der Steiermark ein Vulgoname auf dem Haus ist und nicht auf der Familie. Ich sollte also zur „Ofnerin" werden. Das hat mich zur Frage geführt: Wie funktioniert es hier? Mein Außenblick hat mich Qualitäten sehen lassen und das, was in dieser Region besonders ist, und dann habe ich überlegt, wie ich unterstützen kann, dass es so weitergeht.
Für eine Gesellschaft ist es wichtig zu sehen, woher man kommt, damit man lernt, wo man ist und wohin man geht. Glauben Sie, dass Sie mehr Zeit haben, weil sie auf dem Land leben? Ich frage mich das selbst oft und stelle fest, dass das Gegenteil der Fall ist.
Ich habe nicht mehr Zeit. Man arbeitet ständig - im Betrieb, mit den Schafen, im Haus. Für meine künstlerische Arbeit blockiere ich Zeit; so kann ich konzentriert und am Stück arbeiten.
Ihre Tochter begibt sich auch in die künstlerische Richtung?
Ja, meine Kinder haben einen spannenden Zugang zu meiner künstlerischen Arbeit gehabt. Die Schulen haben leider entgegengewirkt. Meine Tochter wollte nach Wien in die Oberstufe und hat im letzten Schuljahr bereits in einer Wohnung gewohnt. Es hat sie in den darstellenden Bereich gezogen, in ein Kollektiv in Berlin, dann zur sozialen Arbeit, damit sie ihrer Meinung nach etwas bewirken konnte. Nun lebt sie als Künstlerin in Wien.
Welche Beziehung haben Sie zur Orgel?
Na ja, ich habe zur Orgel eingeheiratet. Als katholisch erzogene Tochter kannte ich Orgel von Gottesdiensten. Das für mich Spannende daran ist, dass die Orgel als Ein-Personen-Orchester konzipiert ist. Sozusagen mit Händen und Füßen zu bedienen. Auch fasziniert mich, dass Orgeln oft in großartigen Räumen mit gefinkelter Akustik aufgebaut sind.
Bitte erzählen Sie noch er Ihre Vorliebe für Textilien. Hat das mit Vorarlberg zu tun? Mit handwerklichen Fähigkeiten?
Meine Mutter hat für uns vier Kinder das Gewand genäht. Es gab immer Knöpfe, Reißverschlüsse, Knöpfe, Stoffreste, die ich für meine Schatzkiste bekommen habe, um für die Puppen zu nähen. Eine Begeisterung dafür, etwas herzustellen, hatte ich immer, und es hat sich in die Richtung der textilen Gestaltung entwickelt. Ich habe bemerkt, dass man viele Techniken beherrschen muss, um umzusetzen, was man erreichen möchte. Das monotone Arbeiten macht mein Hirn frei, die Gedanken werden sortiert, neu geordnet.
Ich liebe auch die die starken weiblichen Figuren der Mythologie, Penelope zum Beispiel, die webende, wartende Frau, die schicksalsbestimmenden, Lebensfäden spinnenden Nornen.
Es gibt auch heute Frauen, die viel Lebenszeit in die Herstellung von Handarbeiten stecken. Ich schätze die Fähigkeiten dieser Frauen, nur werden ihre Produkte nicht immer gewürdigt. Deshalb habe ich „Murau strickt" gegründet. Manche Frauen sind unglücklich, wenn sie nicht stricken können. Wenn es dann Menschen gibt, die ihre Produkte wollen, ist das großartig. Wir stricken nun in der Gruppe aus hervorragender Lungauer Schafwolle Socken, die in Graz in der Griesgasse in einem Geschäft verkauft werden. Jede Frau entscheidet natürlich selbst, was sie mit ihrem Erlös tut. Für manche ist das ein wichtiges Zubrot.
Waren Sie schon einmal Artist in Residence?
Zwei Mal war ich Artist in Residence. Einmal in Brooklyn, im Kenten International Drawing Space (das war eine Zusammenarbeit mit zwei Künstler*innen - wir haben ein Objekt aus Papiermaché gestaltet und bemalt) und einmal in Gent als Experimental Intermedia Artist in Residence, wo ich gemeinsam mit Phil Niblock an einem Film gearbeitet habe. Einmal war ich dann noch kurz vor dem zweiten Jugoslawienkrieg in Novi Sad. Das war ein Austausch mit der Künstlergruppe Apsolutno.
Mit Kindern ist das „Artist in Residence"-Konzept eher schwierig. Aber es ist großartig, versinken zu können, einfach eintauchen in die eigene Arbeit.
Wie sind Sie dazu gekommen, Ausstellungen zu kuratieren?
Das hat sich eher zufällig ergeben. Ein Bekannter hat in Kärnten damit begonnen, ein Schaufenster zu bespielen. Er ist Historiker und Volkskundler. Ich sollte kuratorisch mitwirken, also habe ich jedes Jahr ein Projekt aus dem Bereich der Arbeitswelt für diesen Ort erarbeitet.
Wichtig für mich war die „Regionale XII". Da habe ich mich mit dem Murauer Handwerksmuseum und dem Krakauer Dorfmuseum auseinandergesetzt und das Spannungsfeld von totem Museum versus lebendige Kunst bearbeitet. Das Murauer Handwerksmuseum ist im alten Kapuzinerkloster untergebracht.
Es hat eine bemerkenswerte, umfangreiche Sammlung, aber keinen Bezug zu den Menschen. Also habe ich mit der Methode von Oral History Murauerinnen und Murauer gebeten, über ihre Arbeit und ihre Betriebe zu erzählen. Auf diese Weise wurde eine soziokulturelle Verknüpfung zu den Exponaten hergestellt, diese filmisch dokumentiert. Die Arbeitswelt der Gegend wird so über menschliches Tun und Erleben innerhalb der spezifischen Rahmenbedingungen erfahrbar gemacht.
Arbeiten Sie noch immer im Museum?
Ja. Dort bin ich eine der jüngsten Aktivistinnen (lacht). Glücklicherweise gibt es jetzt einen jungen Volkskundler, der in England ausgebildet wurde und sich einbringen will.
Zuletzt habe ich die Ausstellung „Lieblingsstück" konzipiert. Diese zielt darauf ab, Menschen auch außerhalb des Museums anzusprechen und für die Sammlung zu interessieren. Bei Bushaltestellen findet man Boxen, in denen Sammlungsstücke ausgestellt sind. Auf diese Weise können wir Menschen integrieren, die eher nicht ins Museum gehen. In der Pandemiezeit ist das eine gute Möglichkeit, Dinge kennenzulernen, ohne die sowieso bestehende Hemmschwelle „Museum" überwinden zu müssen.
Darf ich Sie bitten, auch noch von den „Murauerinnen" zu sprechen?
Die Idee hatte ich im Nachspann der „Regionale". Ich wollte das Tun und die Beteiligung der Frauen am Leben im Bezirk sichtbar machen. Denn immer wieder sind es beispielsweise Männer, die das Bürgermeisteramt bekleiden, obwohl die Frauen die Politikerinnen sind. Im ländlichen Raum „regieren" oft Frauen und stellen es als Leistungen ihrer Männer dar. Ich wünsche mir mehr Selbstbewusstsein für die Frauen. So gab es etwa im Kontext des Festivals „STUBENrein" das Projekt „Bäuerinnenstube". In einer Tenne wurden Strohballen arrangiert, um eine gemütliche Atmosphäre zu erzeugen. Fünf Frauen unterschiedlichen Alters, Hofführerinnen, haben über ihre berufliche und private Situation gesprochen. Es gab Impulsvorträge und dann eine geleitete Podiumsdiskussion. Da haben Frauen auch Dinge anklingen lassen, über die man sonst nicht spricht. Es ging um Überforderung, schwierige Schwiegermütter, finanzielle Sorgen, Mangel an Anerkennung und Urlaub, Krankheit und Kur als Flucht.
Was wünschen Sie sich an künstlerischen Möglichkeiten am meisten für Ihre Gegend?
Dass die Materialbeschaffung einfacher ist. Und Nähcafés. Orte zwischen sozialem Erleben, Menschen-Treffen und technisch-künstlerischer Unterstützung fehlen. Es geht um den Ort der Gemeinschaft, an dem man sich austauschen kann. Junge Menschen haben oft keinen Platz, etwas zu tun und Know-how zu bekommen.
Kurzbio Ulrike Vonbank-Schedler
Geboren 1961 in Hörbranz. Studierte von 1982-88 Textiles Gestalten an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Lebt seit 1991 bei Murau in der Steiermark.
Petra Sieder-Grabner
September 2021