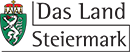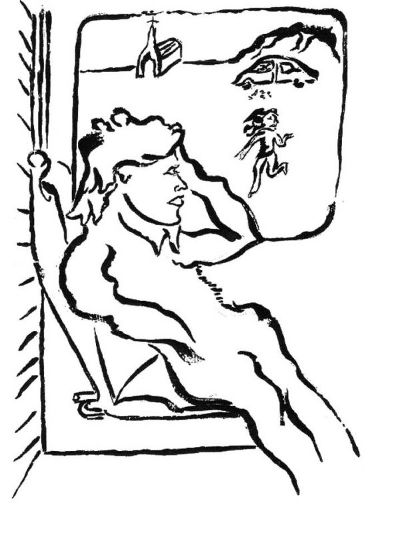An der Grenze dauert die Entzückung am längsten
Der Welt- und Wortreisende Ruud van Weerdenburg bereichert die steirische Kulturlandschaft seit Jahrzehnten.
Ich treffe Ruud van Weerdenburg in der Grazer Stadtbibliothek, einem Ort, an dem wir uns schon öfter begegnet sind. Den meisten Literaturinteressierten dürfte der sympathische Holländer vor allem als Lyriker ein Begriff sein, doch als wir Platz nehmen und er einige seiner mitgebrachten Werke auspackt, wird schnell klar, dass man einer vielseitigen Künstlerpersönlichkeit gegenübersitzt, die zahlreiche vor allem Grazer Kunst- und Kulturinitiativen mitgeprägt hat.
Nach Graz verschlagen hat es van Weerdenburg vor mittlerweile über 35 Jahren. Aus einem Besuch bei der Schwester wurde eine seiner vielen Heimaten; 1956 in Alkmaar geboren, bewegt sich der passionierte Reisende heute u. a. zwischen Graz, Wien und Indien. Im damaligen Graz freilich fand van Weerdenburg das ideale literarische Umfeld vor: Hier konnte man sich noch auf die Spuren von Peter Handke - einem frühen Faszinosum - begeben, hier engagierte er sich mit Alfred Ledersteger und Martin Ohrt bei der perspektive - damals noch eine junge Literaturzeitschrift ohne dezidiert avantgardistisches Konzept -, später mit Harald W. Vetter auch bei den Lichtungen, mit Franz Innerhofer verband ihn eine Freundschaft. Über seine Zeit als junger Redakteur hält van Weerdenburg augenzwinkernd fest, dass es nicht nur literarische Perlen zu entdecken gab: „Man brütete nächtelang über Säcken von Manuskripten, doch fast alle Texte handelten von Ärzten, die von ihren Patientinnen verführt werden."
Solche wunderbaren kleinen Geschichten gibt es im Gespräch zuhauf; eine Anekdotensammlung über seine zeitweilige Beschäftigung als Leiter eines Schreibkurses wäre zweifellos eine eigene Publikation wert. Es ist eine heitere Gelassenheit, die der Holländer ausstrahlt, welche durchaus mit seiner intensiven Beschäftigung mit der östlichen Philosophie zu tun haben mag und auch in seiner künstlerischen Tätigkeit Niederschlag findet. Dabei ist es nachrangig, welche Kunstform gewählt wird: „Da ich in mehreren Sprachen schwimme, geht es immer zuerst um Bilder, die man ausarbeitet." So kann es durchaus sein, dass der Dichter van Weerdenburg ein Bild des Malers van Weerdenburg vertont und der Musiker van Weerdenburg sich mit der Bambusflöte selbst begleitet.
Was das Schreiben betrifft, gilt jedoch: „Lyrik ist die Basis von allem." Poesie ist nicht nur Ausdrucksmittel, sondern vielmehr eine Haltung zur Welt. Dementsprechend sind es existenzielle Themen, die van Weerdenburgs Gedichte durchdringen: Liebe und Vergänglichkeit, Kunst und Natur, Alltag und Transzendenz. Mal sind es längere philosophische Meditationen, mal wenige Zeilen umfassende Alltagsnotizen, die zur Reflexion einladen. Hier stellvertretend zwei Beispiele aus den Gedichtbänden „Bienenmantel" (Löcker 2020) und „Enthauptetes Licht strahlt in der Nacht" (Löcker 2014):
DIE WETTE
Das Geräusch von Wind im Schatten des sich fortschiebenden
Herbstblattes in der Nacht,
weiß wieder eine andere Facette des Glücks preiszugeben
als das, an das wir denken, wenn wir wetten
AUF DER GRENZE
Wolken sind heute auf
Einen hellblauen Himmel geklebt.
Wo beginnt der Regen?
An der Grenze dauert die Entzückung
am längsten
Grenzen lotet van Weerdenburg sowohl in geografischer als auch in sprachlicher Hinsicht aus, ist er doch stets mehrere Monate pro Jahr „on the road". Dabei finden in seinen literarischen Reiseberichten „Parallelentdeckungen zwischen Morgen- und Abendland" (The Global Player) ebenso Platz wie alltägliche Erlebnisse mit und in der österreichischen Bahn (nachzulesen etwa im „Augustin"). Veröffentlicht werden seine Texte auf Niederländisch, Deutsch und Englisch. Gefragt nach den Unterschieden, meint van er lakonisch: „Mein Geld zähle ich auf Deutsch, das ist härter und genauer. Niederländisch ist malerischer, Englisch gefühlvoller." Und wie bei jedem ernsthaften Künstler ist auch ihm der Zweifel ein ständiger Begleiter: „Manchmal denke ich, die Gedichte, die ich als 13-Jähriger nach der Schule geschrieben habe, waren die besten. Heute kommt mir vieles gekünstelt vor." Über abgelehnte Romanmanuskripte ist er mittlerweile froh, wenngleich er sich vom Roman nicht gänzlich abgewendet hat. In der Schublade jedenfalls liegt so einiges.
„Ich bin gerne in guter Gesellschaft", lächelt van Weerdenburg, als man einige der mitgebrachten Publikationen durchblättert, bei denen er seine Finger im Spiel hatte oder noch immer hat: Tinctur. Zeitschrift für Literatur und Kunst, The Global Player, Reibeisen, Montauk, Bikinifisch ... die Liste ließe sich fast beliebig erweitern. Schließlich überreicht er mir noch einen Band mit 100 Bildern, die er in Indien gefertigt hat, als Geschenk. Es existieren bereits derer vier sowie auch Texte zu den hunderten Zeichnungen. Van Weerdenburg tippt auf das Coverbild, auf dem er eine Moschee gezeichnet hat: „Freunde meinen, das sei ein Atomkraftwerk". Und noch einmal gemeinsames herzliches Lachen. Beschenkt, nicht nur im materiellen Sinne, verabschiedet man sich, und der Dichter macht sich wieder auf den Weg, diesmal zu Fuß. Es gibt noch viel zu entdecken.
Mario Hladicz
Dezember 2024