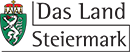Schreiben in anderen Welten
Die Autorin Julia Knaß bewegt sich literarisch durch digitale Medienuniversen.
Die Generation Y wuchs mit digitalen Medien auf. Es war ein gemeinsames Experimentieren, ein Ausprobieren neuer Handlungs- und Spielräume, und es ist nach wie vor der angstfreie, selbstverständliche Zugang, den die Schriftstellerin und Schreiberin Julia Knaß locker aus dem Ärmel schüttelt.
Sie trennt die beiden schreiberischen Sphären strikt voneinander: Im journalistisch-wissenschaftlichen Metier ist sie unter ihrem bürgerlichen Namen Julia Wurzinger tätig, als Schriftstellerin unter dem Pseudonym Julia Knaß. Der Nachname stammt von der Oma väterlicherseits aus Eibiswald. Als Julia Knaß bewegt sie sich durch die unterschiedlichen Genres Prosa, Lyrik und Essay und überführt diese innovativ in Social-Media-Formate, etwa Twitter-Nachrichten, Blogs und Open-Text-Dokumente, die gemeinsam weitergeschrieben werden. Gemeinsam mit Klaus Stoertebeker gestaltet sie die unabhängige Lesereihe „zusammen lesen" in Graz.
Was war deine erste Reaktion, als du von der Zuerkennung des Stipendiums für innovative Schreibtechniken des Landes Steiermark erfahren hast?
Ich habe sofort meiner Kollegin Anna Neuwirth geschrieben, dass ich mein erstes Stipendium gewonnen habe.
Was sind deine konkreten Pläne mit dem Stipendium?
Ich fokussiere mich auf das kollektive Schreiben, auf das echte gemeinsame Schreiben mit Anna Neuwirth. Als „Julianna" arbeiten wir an Cloud-Dokumenten, ein immer fortlaufender Chat, in dem wir eine eigene Sprache entwickeln, die in die Dokumente einfließt.
Ich schreibe auch gemeinsam mit anderen jungen Literatinnen wie Nadine Nebel, Lisa Schantl und Michelle-Francine Ulz für „Die gelbe Tapete". Der Titel ist eine Anlehnung an die Kurzgeschichte von Charlotte Perkins Gilman aus dem 19. Jahrhundert, in der es um eine wegen ihrer „Hysterie" eingesperrten Frau geht. Zudem arbeite ich an zwei längeren Textprojekten gemeinsam mit Anna Neuwirth: In „Rote Flecken denken" und "Mein Kopf will ohne mich sein". Darin geht es um psychische Erkrankungen bzw. Lyrik geht. Gleichzeitig arbeite ich an einem Romanprojekt mit dem Arbeitstitel „Draußen ein Gespenst". Früher dachte ich, dass ich fokussiert an einem Projekt bleibe, jetzt sind es viele gleichzeitig und parallel. Ich würde gerne ein längeres Text- oder Buchprojekt abschließen.
Wie bist du zum Schreiben gekommen?
Es war für die kleine Schwester: Katzengeschichten, die ich geschrieben und ihr vorgelesen habe.
Wie schreibst du?
Ich schreibe im Bett oder im Atelier, ich mache Notizen im digitalen Bereich. „ich komme von Internet" - in Anlehnung an Peter Handkes Reaktion „Ich komme von Homer". [Peter Handke entgegnete Kritikern, die ihm anlässlich der Zuerkennung des Literaturnobelpreisträgers eine bedenkliche Nähe zu Slobodan Milosevic vorwarfen, sie mögen ihn mit diesen Banalitäten verschonen; denn er stehe literarisch in einer Linie mit den ganz Großen: „Ich komme von Homer. - Anmerkung der Redaktion.] Ich habe aber auch analoge Notizbücher.
Wie schwierig ist ein Denken „Out of the Box" beim innovativen Schreiben außerhalb von Gattungen und Genres? Welche Ideen verfolgst du?
Es ist nicht der klassische Zugang zur Literatur, Twitter- und Meme-Texte zu erstellen. Ich habe gemeinsam mit Thomas Hainscho einen Doombot entwickelt, eine textgenerierende Software mit veränderbaren und gleichbleibenden Elementen. Für die Syntax erstellten wir Vokabellisten. Ursprünglich wurden Lyriktexte mit Weltuntergangsszenarien für einen Twitter-Account generiert und auf der Website doomscrolling.at veröffentlicht. Wir haben das Projekt im August 2024 beendet.
Wo siehst du die Grenze oder den Unterschied zwischen Sprachkunst und Literatur?
Ich sehe keine Grenzen. Der Unterschied liegt in den Machtverhältnissen in der Literatur. Die hierarchische Wertung, wo was veröffentlicht wird. Denn Personen, die im Internet schreiben, haben literarisch weniger Wert und Renommee als jene, die bei einem Verlag verankert sind.
Du warst auch als Journalistin tätig. Wo sind für dich die grundlegenden Unterschiede?
Ich war zwei Jahre lang in Wolfsberg in Kärnten bei den Unterkärntner Nachrichten tätig, das war eine kleine Redaktion, wo ich über alles schrieb, außer Sport. Ich war redaktionell auch für die Kultur zuständig und lernte die freie Kulturszene Kärntens kennen.
Gleichzeitig Journalistin und Künstlerin zu sein, ist schwierig, weil für die journalistische Tätigkeit die Distanz zu den Kolleg*innen in Sachen Kunst und Kultur fehlt.
In welche Welt begibst du dich beim Schreiben?
Grundlegend in surreale Traumwelten, die von Sprachlosigkeit und Angstszenarien bestimmt sind. Es geht mir um die Auseinandersetzung mit Machtverhältnissen aus einer feministischen Perspektive. Dabei ist für mich Hertha Kräftner eine wichtige Autorin, auch weil ihre Texte an der Kippe zwischen wirklich und surreal stehen.
Wie gestaltet sich bei dir die Recherchetätigkeit?
Mit sehr viel Lesen. Mein Interesse an der Heterotopie, wie sie für Räume angewandt wird, ist sehr groß. In der Literatur sind deren ordnungssystematischen Bedeutungen anders als in der Architektur. So ist die Form eines Romans im amerikanischen Bereich innovativer als in der europäischen Literatur.
Die Recherche ist eine Arbeit im Hintergrund, die ich nicht aufschlüsseln kann.
Was sind deine idealen Zukunftspläne?
Die Möglichkeit schaffen, in Wörter hineinzugehen. Durch den konkreten Plan, einen Text von mir so zu programmieren, dass er dreidimensional wird und man durch ihn hindurchgehen kann wie durch eine Höhle oder einen Raum. Ich bin aber erst am Anfang der Beschäftigung damit.
Kurzbio Julia Knaß alias Julia Wurzinger
Geboren 1988, studierte Germanistik und interdisziplinäre Geschlechterstudien an der Universität Graz. Sie war journalistisch bei verschiedenen Medien tätig, zuletzt bei den Unterkärntner Nachrichten. Gemeinsam mit Raffael Hiden ist sie Herausgeberin der Literaturzeitschrift „mischen". Teil des Druckkollektivs „RISOGRAD" in Graz. Zahlreiche textliche Tätigkeiten digital und analog.
Text aus der Begleitpublikation zu den
Kunst- und Kulturpreises des Landes Steiermark 2024
Stand: Oktober 2024